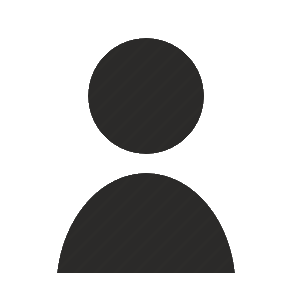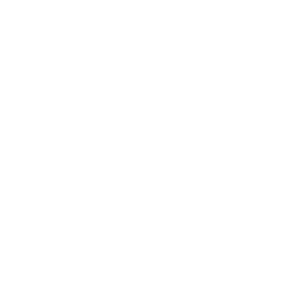This document is unfortunately not available for download at the moment.
Über Sprachmelodisches in der deutschen Dichtung
Eduard Sievers
pp. 115-134
1Die Frage, für deren Erörterung ich Ihre Aufmerksamkeit erbitten möchte, bildet einen Teil des allgemeinen Problems: Wie und wie weit kann eine planmäßige Untersuchung der rhythmisch-melodischen Formen der menschlichen Rede in Sprache und Literatur auch ästhetischen und philologischen Zwecken nutzbar gemacht werden? Oder genauer gesagt: Inwiefern kann eine solche Untersuchung einerseits unser Verständnis der Kunstformen der Rede und ihrer Wirkungen fördern, und inwieweit lassen sich aus ihr andrerseits etwa neue Anhaltspunkte für die Kritik gewinnen?
Es versteht sich von selbst, daß bei der systematischen Untersuchung des ganzen Problems Rhythmisches und Melodisches in stetem Hinblick aufeinander zu behandeln sind : denn sie sind ja in der Rede selbst stets zu gleichzeitiger und gemeinsamer Wirkung verbunden. Es würde aber unmöglich sein, im Rahmen eines Vortrags beiden Seiten gleichmäßig gerecht zu werden. Ich werde mich also darauf beschränken, das Melodische in der deutschen Literatur, und noch spezieller nur in der deutschen Dichtung etwas näher ins Auge zu fassen, als denjenigen von den beiden Faktoren, der bisher am wenigsten Beachtung gefunden hat.
Ich beginne mit einer kurzen Vorerinnerung.
Was man als Sprachmelodie zu bezeichnen pflegt, ist nicht in allen Punkten den musikalischen Melodien, speziell den Gesangsmelodien, gleich zu denken, trotz mancher Berührungen der beiden Gebiete. Im Gesang gebrauchen wir die Singstimme, in der Rede die Sprechstimme, die an sich durch ein Mindermaß musikalischer Eigenschaften charakterisiert ist. Die Musik arbeitet hauptsächlich mit festen Tönen von gleichbleibender Tonhöhe, die Sprache bewegt sich vorwiegend in Gleittönen, die innerhalb einer und derselben Silbe von einer Tonhöhe zur anderen auf- oder absteigen. Insbesondere aber bindet sich die Sprache nicht an die fest bestimmten Tonhöhen und Intervalle der musikalischen Melodien: sie keimt nur ungefähr bestimmte Tonlagen, und ihre Tonschritte sind zwar meist der Richtung nach (ob Steigschritt oder Fallschritt) fest gegeben, aber nicht auch der Größe nach, vielmehr kann diese nach den verschiedensten Gesichtspunkten wechseln. Man darf also bei [54] der ganzen Untersuchung auch in der Poesie nur relative Tonverhältnisse zu finden erwarten, nicht die festen Verhältnisse der Musik.
Dies vorausgesetzt, drängen sich einem jeden bei Betrachtung unseres Problems wohl zunächst folgende Fragen auf. Wenn wir Poesie vortragen, so melodisieren wir sie, wie alle gesprochene Rede. Woher aber stammt in letzter Linie die Melodie, die wir so dem Texte bei- gesellen? Tragen wir sie lediglich als unser Eigenes in ihn hinein, oder ist sie bereits in ihm gegeben, oder doch so weit angedeutet, daß sie beim Vortrag sozusagen zwangsweise aus uns herausgelockt wird? Und wenn sie so von Hause aus schon dem Text innewohnt, wie kommt sie in ihn hinein, und inwiefern kann sie wieder auf den Vortragenden einen Zwang zu richtiger Wiedergabe ausüben?
Alle diese Fragen lassen sich natürlich nur in annähernd fester Form beantworten. Daß der Einzelne in das einzelne Gedicht oder den einzelnen Passus eine individuelle Auffassung hineintragen und es demgemäß individuell melodisieren kann, ist bekannt und zugegeben, desgleichen, daß er es oft wirklich tut. Ebenso sicher ist aber auch, daß die Mehrzahl der naiven Leser, die ein Gedicht oder eine Stelle unbefangen auf sich wirken lassen, doch in annähernd gleichem Sinne melodisiert, vorausgesetzt, daß sie Inhalt und Stimmung wenigstens instinktiv zu erfassen vermögen und den empfangenen Eindruck auch stimmlich einigermaßen wiederzugeben imstande sind. Diese Gleichartigkeit der Reaktion aber weist sichtlich auf eine Gleichartigkeit eines beim Lesen unwillkürlich empfundenen Reizes hin, dessen Ursachen außerhalb des Lesers und innerhalb des Gelesenen liegen müssen. Wir dürfen also überzeugt sein, daß jedes Stück Dichtung ihm fest anhaftende melodische Eigenschaften besitzt, die zwar in der Schrift nicht mit symbolisiert sind, aber vom Leser doch aus dem Ganzen heraus empfunden und beim Vortrag entsprechend reproduziert werden. Und kann es dann zweifelhaft sein, daß diese Eigenschaften vom Dichter selbst herrühren, daß sie von ihm in sein Werk hineingelegt worden sind?
Die Sache liegt offenbar so, daß der Akt der poetischen Konzeption und Ausgestaltung beim Dichter mit einer gewissen musikalischen, d.h. rhythmisch-melodischen Stimmung verknüpft ist, die dann ihrerseits in der spezifischen Art von Rhythmus und Sprachmelodie des geschaffenen Werkes ihren Ausdruck findet. Bedürfte es dafür äußerer Zeugnisse, so ließen sich auch die unschwer in reichlicher Fülle auffinden: hier will ich nur zweier einschlägiger Äußerungen gedenken. 'Mir ist zwar von Natur', so läßt Goethe einmal seinen Wilhelm Meister sagen,2 'eine glückliche Stimme versagt, aber innerlich scheint mir oft ein geheimer Genius etwas Rhythmisches vorzuflüstem, so daß ich mich beim Wandern jedesmal im Takt bewege und zugleich leise Töne zu vernehmen glaube, wodurch denn irgendein Lied begleitet wird, das sich mir auf eine oder die andere Weise gefällig vergegenwärtigt’. Und ohne Einschränkung auf das Lied und die etwaige Besonderheit der Situation schreibt [55] Schiller an Körner3: 'Das Musikalische eines Gedichtes schwebt mir weit öfter vor der Seele, wenn ich mich hinsetze, es zu machen, als der klare Begriff vom Inhalt, über den ich kaum mit mir einig bin’. Diese Worte bedürfen keines Kommentars: es genügt, auch durch sie die Priorität oder mindestens die Gleichzeitigkeit der wirkenden Stimmung an charakteristischen Beispielen festgelegt zu sehen.
Daß der Dichter sich jener musikalischen Erregung stets oder in der Regel bewußt werde, folgt weder aus Äußerungen wie den vorgeführten, noch ist es an sich irgend notwendig. Für unsere Zwecke ist auch diese Frage ohne direkte Bedeutung. Ich unterlasse es also, auf sie einzugehen. Ebensowenig ist es hier erforderlich, Grad und Charakter der Erregung näher zu untersuchen. Wohl aber muß über die Art ihrer Wirkung noch ein Wort gesagt werden.
Auch diese ist einfach zu verstehen. Alle gesprochene Rede hat, wie wir wissen, rhythmisch-melodischen Charakter. Dieser wird im einzelnen geregelt durch entweder traditionelle oder individuelle Sprechgewohnheit, welche für jede kleinere oder größere Begriffsgruppe bestimmter Art auch eine bestimmte rhythmisch-melodische Formel zur Verfügung stellt. Inhalt und Form aber sind in der naiven Alltagsrede in der Regel so verbunden, daß das Inhaltliche die erste, das Formelle die zweite Stelle einnimmt, mithin auch die rhythmisch-melodische Form des Gesprochenen nur mehr als eine ungesuchte Beigabe zu dem gewollten Inhalt erscheint.
Anders, sobald die Rede sich höhere Ziele steckt. Wer neben der inhaltlichen Wirkung zugleich eine Formwirkung erzielen will, muß auch auf den Wohllaut seiner Rede Bedacht nehmen, und er kann dieser Auf- gäbe durch entsprechende Wortwahl gerecht werden, indem er nur solche Wörter und Wortgruppen in die Rede einstellt, die bei ungezwungener Betonung dem Ohr gefällige Rhythmen und Tonfolgen darbieten. Das gilt von der Prosa wie von der Poesie. Nur ist ein wesentlicher Gradunterschied vorhanden. Zwar kann selbstredend auch die Prosa im Einzelfalle ein individuelleres rhythmisch-melodisches Gepräge erhalten, aber im Prinzip bleiben doch bei ihr Rhythmus und Melodie von Fall zu Fall frei beweglich. Die Poesie aber legt sich von vornherein, schon durch die Wahl eines bestimmten Versmaßes, gewisse Formschranken auf. Zunächst wird dadurch zwar nur die Freiheit der rhythmischen Bewegung eingeschränkt: aber die größere Gleichmäßigkeit der rhythmischen Form treibt, nicht notwendig, aber doch oft und unwillkürlich, auch zu festerer Regelung des Melodischen, das ja, wie man weiß, an sich das wirksamste Variationsmittel für den Ausdruck qualitativ verschiedener Stimmungen ist. Um so stärker aber wird der Trieb zu prägnanterer Regelung des Melodischen hervortreten, je mehr der Dichter während des Gestaltungsprozesses unter dem Einfluß einer jener allgemeinen suggestiven Melodievorstellungen steht, deren wir oben gedachten, und je charakteristischere Formen die vor-[56] gestellten Melodien haben. Um so mehr wird dann der Dichter jedesmal auch positiv darauf Bedacht nehmen, seine Worte so zu wählen, daß sie sich in das vorgestellte melodische Ausdrucksschema gut ein- fügen, und negativ darauf, zu meiden, was dieser Forderung nicht genügt.
Übt nun so die vorgestellte Melodie beim arbeitenden Dichter einen nicht gering anzuschlagenden suggestiven oder prohibitiven Einfluß auf die Wortwahl aus, so veranlaßt umgekehrt die von ihm getroffene Wortwahl beim
Leser auch wieder die Auslösung bestimmter Melodien, wenn er einen dichterischen Text nach den ihm für die einzelnen Wortfolgen und Wortgruppen geläufigen traditionellen Betonungsweisen in laute Rede umsetzt. Dabei wird der Leser die Melodien des Dichters wenigstens ihrem Grund charakter nach um so sicherer und treuer reproduzieren, je naiver und reflexionsloser er sich dem Gelesenen hingibt, d. h. je mehr sein Vortrag den Charakter einer unwillkürlichen Reaktion auf unbewußt empfangene Eindrücke trägt. Das ist wenigstens, wie ich hier ohne nähere Rechtfertigung einschalten möchte, das Ergebnis meiner Beobachtungen, und es muß um so schärfer hervorgehoben werden, als eine solche Leseweise unserer modernen Vortragsgewöhnung widerspricht, die weniger auf Hervorhebung des Gemeinsamen als des Individuellen und Gegensätzlichen ausgeht, und die es demgemäß liebt, das dichterische Kontinuum verstandesmäßig in kleinste Einzelteile zu zerschlagen und diese dann miteinander in scharf pointierten Kontrast zu setzen.
Nach allem diesem ist die oft und vorsichtig wiederholte Reaktionsprobe das erste und wichtigste Hilfsmittel, dessen man sich bei der systematischen Untersuchung des Melodischen in der Literatur zu bedienen hat. Diese Probe aber muß zwiefacher Natur sein.
Einmal muß der Untersuchende sie an sich selbst vornehmen, schon um überhaupt die verschiedenen melodischen Typen, die in den Texten verborgen liegen, in ihrer Eigenheit erfassen und scheiden zu lernen. Aber auch noch aus einem anderen wichtigen Grunde. Gerade die Methode der einseitigen Untersuchung bringt nämlich einen Faktor von annähernder Konstanz in die komplizierte Rechnung, ich meine die im wesentlichen doch gleichbleibende Auffassungs- und Reaktionsweise des Einzelindividuums, die eben durch ihre Konstanz eine gewisse Gewähr dafür bietet, daß melodische Eigenschaften und Verschiedenheiten der Texte beim Vortrag auch wirklich proportionalen Ausdruck finden.
Damit wäre schon ein nicht unwesentlicher Punkt gewonnen. Aber es muß bei der Einzeluntersuchung dunkel bleiben, ob die erhaltenen Proportionalreaktionen auch wirklich ein gleichsinniges Abbild des vom Dichter Gewollten ergeben, und nicht etwa ein umgelegtes oder sonstwie verschobenes Spiegelbild. Auch werden ja dem Einzelnen bei der intuitiven Reproduktion der Texte stets subjektive Interpretationsfehler mit unterlaufen, oder er selbst schwankt, wie er diese oder jene Stelle wiedergeben soll. Hier muß also eine vergleichende Massenuntersuchung ergänzend eintreten, d. h. die zweite Aufgabe des Untersuchenden muß sein, die Resultate seiner Selbstprüfung mit [57] den unter tunlichst gleichen Bedingungen zu gewinnenden Reaktionen anderer Leser zusammenzuhalten und dann auf dem Wege vorsichtigster Ausgleichung etwaiger Differenzen eine Einigung anzustreben, soweit das ohne Zwang möglich ist.
Ergibt sich auf dieser zweiten Stufe der Untersuchung, daß Texte von sichtlich verschiedener melodischer Qualität von den verschiedenen Lesern in gleichem Sinne melodisiert werden, und darf man zugleich mit Grund annehmen, daß die Leser mit ihrer Sprachmelodik nach Herkunft oder Gewöhnung auf demselben Boden stehen wie der oder die Dichter, so darf man schon mit einiger Zuversicht hoffen, in den gemeinschaftlichen Reproduktionen ein wirkliches Parallelbild zu den vom Dichter in die Texte hineingelegten Melodietypen erhalten zu haben.
Dieser günstige Fall tritt aber bei weitem nicht überall ein, auch nicht, wenn man nur aufs Ganze geht und einzelne Differenzen, die sich überall finden, als nebensächlich beiseite läßt. Vielmehr spaltet sich, wenn man mit einer größeren Zahl von Lesern zusammenarbeitet, deren Schar ganz gewöhnlich, trotz nachweislich gleicher Auffassung von Inhalt und Stimmung des Gelesenen, in zwei scharf getrennte Lager. Das eine melodisiert dann in einem, das andere in genau umgekehrtem Sinne. Oder, wo bei der einen Gruppe von Lesern hohe Tonlage herrscht, wendet die andere Gruppe tiefe Tonlage ah, wo die eine Gruppe die Tonhöhe steigen läßt, läßt die andere sie sinken, und umgekehrt.4 Auch in diesem Falle bleibt zwar, wie man sieht, das Prinzip der Proportionalreaktion gewahrt, das auf immanente Verschiedenheit der Texte zu schließen gestattet, nur kann man dann ohne das Hinzutreten weiterer Entscheidungsgründe (die es übrigens meist gibt) nicht wissen, welche von den beiden gegensätzlichen Melodisierungsarten vermutungsweise mit der des Dichters selbst zu identifizieren ist.
Diese Umlegung der Melodien, wie man die ganze Erscheinung wohl nennen kann, sieht zunächst befremdlich aus. Aber sie verliert bald alles Auffällige, wenn man ihren Gründen nachgeht. Sie beruht nämlich einfach darauf, daß im Deutscheil überhaupt zwei konträre Generalsysteme der Melodisierung einander gegenüberstehen, auch in der einfachen Alltagsrede. Diese Systeme wiederum sind landschaftlich geschieden. Wir kennen zwar die geographischen bzw. dialektologischen Grenzlinien der beiden Gebiete noch nicht genauer, im ganzen herrscht aber doch das eine Intonationssystem im Norden, das andere im Süden des deutschen Sprachgebietes, während das Mittelland in sich mehrfach gespalten ist.5 Man kann daher die beiden Systeme vorläufig wohl als das norddeutsche und das süddeutsche bezeichnen, natürlich [58] unter dem Vorbehalt, daß weitergehende Untersuchungen erst noch zu lehren haben werden, ob das, was uns jetzt als ein einheitliches Gesamtsystem erscheint, nicht vielmehr in eine Anzahl von Untersystemen zu zerlegen ist, die nur in gewissen Hauptzügen Zusammengehen. Meine eigene Intonationsweise folgt, beiläufig bemerkt, dem norddeutschen System. Ich werde also sicher einen Teil meiner verehrten Hörer bitten müssen, die Einzelangaben, die ich im folgenden zu machen habe, in ihr Gegenteil zu verkehren, damit sie auch für sie direkt verständlich werden.
Die dialektische Umlegung des Tonischen ist in der Regel leicht zu fassen. Bei ruhiger, leidenschaftsloser Rede handelt es sich, soweit wir bisher wissen, in der Tat dabei nur um direkte Umkehrung aller Tonverhältnisse, sobald wir aus dem einen Gebiet in das andere hinübertreten. Nur für den Ausdruck stärkerer Affekte trifft das nicht immer zu. Aber es ist klar, daß auch etwaige Störung der Entsprechung in der Affektrede durch genauere Ermittelung der hier in den einzelnen Sprachgebieten herrschenden Transpositionspraxis generell beseitigt werden können.
Schwieriger ist es, den individuellen Differenzen beizukommen, in Fällen, wo die subjektive Auffassung des einzelnen Lesers für die Melodisierung im einen oder anderen Sinne maßgebend ist, mag nun diese Auffassung bloß auf Intuition beruhen, oder durch bewußtes Räsonnement gewonnen sein. Hier bleibt schließlich nichts anderes übrig, als gemeinschaftliche Diskussion der Einzelstelle in ihrem Zusammenhang mit dem Gesamtcharakter des Werkes, dem sie angehört. Dieser Gesamtcharakter des Einzelwerkes, auch im Melodischen, ist also jedesmal zuerst festzustellen, und zwar auf Grund derjenigen (an Umfang übrigens meist sehr überwiegenden) Partien, bei denen individuelle Verschiedenheiten der Auffassung nicht vorhanden sind. Demnächst aber ist zu untersuchen, ob und wieweit jedesmal das Ganze gewinnt oder verliert, je nachdem man die subjektiv zweifelhaften Stellen beim Vortrag jenem Gesamtcharakter anpaßt oder individuell behandelt. Das Ergebnis dieser Prüfung kann natürlich im einzelnen sehr verschieden sein: stellt ja doch auch unter Umständen absolute Freiheit der melodischen Bewegung einen besonderen und oft sehr wirkungsvollen Typus der dichterischen Form dar. Aber im ganzen glaube ich doch schon jetzt die These aufstellen zu können, daß da, wo überhaupt im Gesamthabitus eines Werkes eine gewisse Bindung des Melodischen greifbar hervortritt, nivellierender Vortrag der subjektiv zweifelhaften Stellen eine reinere und bessere und damit wohl auch eine ursprünglichere Wirkung hervorbringt, als individualisierende Behandlung, und zwar um so mehr, je typischere Formen jener Gesamthabitus aufweist, d.h. je mehr man eine Beherrschung des produzierenden Dichters durch vorgestellte Suggestivmelodien voraussetzen darf.
Daß bei allen hier zutage tretenden Verschiedenheiten der melodischen Formgebung einmal die Verschiedenheit von Stimmung und Affekt, sodann aber auch die Verschiedenheit der dichterischen Produktionsart, namentlich der Gegensatz von Anschauungs- und Empfindungsdichtung einer- und [59] von Gedankendichtung andrerseits eine sehr erhebliche Rolle spielt, will ich hier nur eben anmerken. Ebensowenig brauche ich Sie mit einer systematischen Aufzählung der bisher aufgefundenen verschiedenen melodischen Typen und der Erörterung ihrer Zusammenhänge mit den entsprechenden Stimmungs- und Affektformen zu behelligen, oder gar mit der Besprechung weiterer technischer Kautelen und praktischer Kunstgriffe, deren sich die Untersuchung zu bedienen hat. Wenigstens hoffe ich Ihrer Zustimmung nicht zu entbehren, wenn ich meine, schon aus dem Wenigen und Abgerissenen, was hier zur Sache vorgebracht ist, gehe hervor, daß eine streng wissenschaftliche Analyse des Melodischen auch in der geschriebenen Literatur möglich ist, und daß das Melodische bei der Gesamtwirkung der dichterischen Form ebenso mitspricht wie andere Elemente dieser Form, die von jeher in den Kreis philologischer Forschung gezogen zu werden pflegen. Ist dem aber so, so hat auch das Melodische gerechten Anspruch darauf, regelmäßig mit berücksichtigt zu werden, wo es die Feststellung der poetischen Kunstform gilt.
Es ist also zunächst zu fordern, daß auch das Melodische des einzelnen Dichtwerks sorgfältig untersucht und beschrieben werde. Die Beschreibung selbst hat sich auf alle diejenigen Punkte zu, erstrecken, bezüglich deren etwas Sicheres festgestellt werden kann. Von solchen Punkten kommen einstweilen namentlich folgende in Betracht:
1. Die spezifische Tonlage, d. h. die Frage, ob ein Stück beim Vortrag hohe, mittlere, tiefe usw. Stimmlage erfordert, ob es mit bleibender oder wechselnder Stimmhöhe zu sprechen ist, u. dgl.
2. Die spezifische Intervallgröße, d. h. die Frage, ob der Dichter mit großen, mittleren, kleinen Intervallen arbeitet, wobei insbesondere auf die Grenzen der Minima und Maxima zu achten ist.
3. Die spezifische Tonführung, welche ihrerseits entweder frei oder gebunden ist. Im ersteren Fall reiht sich Ton an Ton ohne ein anderes Gesetz, als daß die Tonhöhe jeweilen dem Sinn und der Stimmung angemessen sei. Im zweiten Fall sind die Tonlagen in der einen oder anderen Weise planmäßig geregelt.
4. Die Anwendung spezifischer Tonschritte an charakteristischen Stellen des Verses, speziell die Anwendung spezifischer Eingänge am Anfang und spezifischer Kadenzen am Schluß der Verse.
5. Die Frage nach den spezifischen Trägern der Melodie. Hier kommt es vor allem darauf an, ob alle Silbenarten des Verses gleichmäßig als für die Melodiebildung wesentlich empfunden werden, oder ob das melodische Schema sich wesentlich nur auf den Tonfolgen der betonten oder betontesten Stellen, also insbesondere der Vershebungen, aufbaut. Letzteres ist im ganzen der gewöhnlichere Fall.
Bei der bloßen Beschreibung dürfen wir uns aber nicht beruhigen. Wir müssen sofort weiter fragen, einmal allgemein: Was und wieviel trägt die Wahl eines bestimmten Typus zur Formcharakteristik und Formwirkung eines Werkes oder eines Abschnitts bei, dann speziell: Welche [60] Wirkungen beabsichtigt und erreicht der Dichter durch etwaigen Wechsel dieses Typus?
Daß es sich hierbei namentlich um die Herstellung charakteristischer Bindungs- und Kontrastformen handeln muß, ist wohl von vornherein klar. Nicht so deutlich ist es aber vielleicht, wie der Dichter im einzelnen diese Aufgabe lösen kann oder tatsächlich löst. Gestatten Sie mir daher, diesen Punkt durch ein Beispiel statt vieler zu erläutern. Ich wähle dazu den Eingang von Goethes Faustmonolog, der überhaupt für unsere Zwecke ungewöhnlich lehrreich ist.
Der erste, unruhig berichtende Abschnitt des Monologs zeigt sogenannten dipodischen Versbau. Für diesen ist in melodischer Beziehung charakteristisch, daß je zwei Nachbarfüße sich dadurch zu einer höheren Einheit zusammenschließen, daß je eine hohe und eine tiefe Hebung gepaart werden, doch mit freiem Wechsel von Hoch und Tief. Man vergleiche etwa die Stelle6:
Da steh’ ich nun, ich armer Tor!
Und bin so klug als wie zuvor;
Heiße Magister, heiße Doktor gar,
Und ziehe schon an die zehen Jahr,
Herauf, herab und quer und krumm,
Meine Schüler an der Nase herum —
Und sehe, daß wir nichts wissen können!
Das will mir schier das Herz verbrennen, usw.
Hier ist der Abstand von Hoch und Tief ziemlich bedeutend, der Rhythmus im ganzen lebendig. Erst gegen den Schluß des ganzen Abschnittes hin wird der kommende Umschlag der Stimmung durch die Wahl schwererer Rhythmusformen und die Verkleinerung der melodischen Intervalle voraus angedeutet:
Drum hab’ ich mich der Magie ergeben,
Ob mir durch Geistes Kraft und Mund
Nicht manch Geheimnis würde kund;
Daß ich nicht mehr, mit sauerm Schweiß,
Zu sagen brauche was ich nicht weiß;
Daß ich erkenne was die Welt
Im Innersten zusammenhält,
Schau’ alle Wirkenskraft und Samen,
Und tu’ nicht mehr in Worten kramen.
Es folgt, nach einer Pause, der zweite Absatz 'O sähst du, voller Mondenschein', der Erguß wehmütig-schmerzvoller Sehnsucht nach Befreiung von drückender Last. Dem Wechsel der Stimmung entspricht der Wechsel von Rhythmus und Melodie. Die dipodische Bindung ist verschwunden, die Intervalle sind auf ein Minimum herabgesetzt, die Stimme wird weicher:
0 sähst du, voller Mondenschein,
Zum letztenmal auf meine Pein,
Den ich so manche Mitternacht
An diesem Pult herangewacht: [61]
Dann, über Büchern und Papier,
Trübsel’ger Freund, erschienst du mir!
Ach! könnt’ ich doch auf Berges-Höhn
In deinem lieben Lichte gehn,
Um Bergeshöhle mit Geistern schweben,
Auf Wiesen in deinem Dämmer weben,
Von allem Wissensqualm entladen
In deinem Tau gesund mich baden!
Nach abermaliger Pause schließt sich hieran mit 'Weh! steck’ ich in dem Kerker noch?' ein Ausbruch stärkster seelischer Erregung, dynamisch und melodisch charakterisiert durch den sprunghaften und unvermittelten Wechsel von Schwach und Stark, von Tief und Hoch. Einzelne Hebungen schießen jäh aus dem Gesamtniveau hervor. Die Stimme hat den lyrischen Klang verloren, der ihr im vorhergehenden Abschnitt eigen war:
Weh! steck’ ich in dem Kerker noch?
Verfluchtes dumpfes Mauerloch,
Wo selbst das liebe Himmelslicht
Trüb durch gemalte Scheiben bricht!
Beschränkt von diesem Bücherhauf,
Den Würme nagen, Staub bedeckt,
Den, bis an’s hohe Gewölb’ hinauf,
Ein angeraucht Papier um steckt, usw.
Neben all dem Kontrast, der hier und weiterhin hervortritt, weist aber die Melodik unseres Monologs, wenigstens in seiner ursprünglichen Fassung, ein durchgehendes und verbindendes Element auf, und zwar in dessen Tiefschlüssen, d. h. der ausgeprägten Neigung, Vers nach Vers auf einer tiefen Note ausklingen zu lassen, wie in: Da steh’ ich nun, ich armer Tor, O sähst du, voller Mondenschein, Weh! steck’ ich in dem Kerker noch? usw. Ja diese Neigung zum Tiefschluß beherrscht im Urfaust auch weiterhin die Reden Fausts. Und das ist kein Zufall, denn sonst spricht dort nur noch Valentin so:
Wenn ich so saß bey 'em Gelag,
Wo mancher sich berühmen mag,
Und all und all mir all den Flor
Der Mägdlein mir gepriesen vor, usw.
Die übrigen Personen ziehen, mit Ausnahme Mephistos, ebenso den Hochschluß vor, d. h. sie lassen den Vers mit einer relativ hohen Note ausgehen, jedenfalls die Tonhöhe am Versschluß nicht um ein stark wirkendes Intervall sinken. Sehr deutlich prägt sich dieser Gegensatz z. B. beim Dialog zwischen Faust und Wagner aus:
Faust.
0 Tod! ich kenn’s: das ist mein Famulus.
Nun werd’ ich tiefer, tief zunichte,
Daß diese Fülle der Gesichte
Der trockne Schwärmer stören muß! [62]
Wagner.
Verzeiht! Ich hört’ Euch deklamieren!
Ihr last gewiß ein griechisch Trauerspiel?
ln dieser Kunst möcht’ ich was profitieren,
Denn heutzutage wirkt das viel.
Ich hab es öfters rühmen hören,
Ein Komödiant könnt’ einen Pfarrer lehren
Faust.
Ja wenn der Pfarrer ein Komödiant ist;
Wie das denn wohl zu Zeiten kommen mag.
Für Mephistos Redeweise endlich ist, um auch das noch zu sagen, ein ruheloser Wechsel von Hoch- und Tiefschlüssen charakteristisch.
Hier sind also, wie man sieht, die einzelnen Personen durch dominierende Formen der Kadenz charakterisiert. Anderwärts treten auch andere Bindungen und Gegensätze hervor, so wenn etwa in der Natürlichen Tochter ohne Rücksicht auf die gerade redenden Personen jeweilen Spieler und Gegenspieler durch entgegengesetzt verlaufende Melodiekurven von steigend-fallender und fallend-steigender Richtung kontrastiert werden.
Aber gerade der Faust kann uns noch ein weiteres lehren, was uns zur letzten Frage unseres Themas hinüberführt.
Das oben geschilderte Verteilungssystem von Hoch- und Tiefschluß gilt, wie schon gesagt, zunächst nur für den Urfaust. Als Goethe die Arbeit am Faust wieder aufnahm, ist er auf diese Form der Charakterisierung nicht wieder zurückgekommen. Die Erinnerung daran war ihm offenbar geschwunden und ist ihm auch bei der Arbeit nicht wieder lebendig geworden. Und so sehen wir ihn denn auch da, wo er alten Text nur umarbeitet oder ergänzt, Kadenzformen einführen, die dem alten System direkt widersprechen. So finden wir jetzt gleich im Eingang des Monologs die Hochschlußverse:
Habe nun, ach! Philosophie,
Juristerei und Medizin,
Und leider auch Theologie!
Durchaus studiert, mit heißem Bemühn,
wo es früher mit den typischen Tiefschlüssen Faustischer Rede hieß:
Hab nun, ach, die Philosophey,
Medizin und Juristerey,
Und leider auch die Theologie
Durchaus studiert mit heißer Müh, u. dgl. mehr.
Hier weist der unmotivierte Wechsel des melodischen Typus sichtlich auf Störungen des ursprünglichen Wortlauts hin, und eben dadurch wird er uns zu einem direkten Hilfsmittel der Kritik.
Auch bei anders gearteten Fragen der neueren deutschen Literaturgeschichte kann die Anwendung dieses Kriteriums ganz hübsche Nebenresultate abwerfen. Sollte es z. B. lediglich ein Spiel des Zufalls sein, wenn von den [63] elf Friederikenliedern gerade nur die sechs alle Merkmale vollendeter Goethischer Melodik aufweisen, welche die neuere Literarkritik einmütig als Goethes Eigentum anerkennt, während die fünf mit mehr oder weniger Zuversicht für Lenz in Anspruch genommenen Lieder sich ganz anderer und viel flacherer Melodieformen bedienen?
Immerhin wird man bei der neueren deutschen Literatur selten darauf angewiesen sein, von unserem Kriterium Gebrauch zu machen. Um so ergiebiger ist die systematische Anwendung der Melodieprobe für die mittelalterliche deutsche Literatur. Das beruht aber wieder auf einem höchst merkwürdigen Umstande, der an sich in keiner Weise theoretisch notwendig wäre, der aber eben durch die Untersuchung der Literaturdenkmäler selbst als tatsächlich zu Recht bestehend erwiesen wird.
Prüft man nämlich die Quellen, deren Echtheit im ganzen und deren Wortlaut im einzelnen keinem kritischen Zweifel unterliegt, so ergibt sich, daß der einzelne mittelalterliche deutsche Dichter, mit ganz wenigen, besonders zu erklärenden Ausnahmen, in der Wahl seiner melodischen Ausdrucksmittel durchaus stabil ist, im direktesten Gegensatz zum modernen oder auch z. B. zu dem mittelalterlichen provenzalischen Dichter, der sich keinerlei derartige Beschränkung auferlegt. Die Stabilität ist in einzelnen Punkten, z. B. bezüglich der Stimmlage, so groß, daß sie fast einer Zwangsbeschränkung ähnlich sieht. Ein norddeutscher Leser mag aufschlagen, wo er will: er wird beispielsweise Hartmann von Aue beim Vortrag unwillkürlich stets tiefer legen als etwa Wolfram von Eschenbach oder gar Gottfried von Straßburg. Wollte er die Tonlagen etwa einmal versuchsweise vertauschen, so würde er eine ganz unnatürliche, oft an das Parodistische streifende Wirkung erzielen. Man kann eben nicht Gottfried mit tiefer Stimme erzählen lassen:
Ein hêrre in Parmenîe was,
der jâre ein kint, als ich ez las:
der was, als uns diu wârheit
an sîner âventiure seit,
wol an gebürte künege genôz,
an lande fürsten ebengrôz,
oder Hartmann hochstimmig:
Ein ritter so gelêret was,
daz er an den buochen las
swaz er dar an geschriben vant.
der was Hartman genant,
dienstman was er ze Ouwe, usw.
Erst wenn wir die falsche Stimmlage umkehren, finden wir den wahren Erzählerton beider Autoren. Auch in der Lyrik ist es nicht anders, der man doch am ehesten nach ihrem wechselnden Stimmungsgehalt auch einen Wechsel der Tonlage beim Einzeldichter Zutrauen möchte: Hartmanns echte Lieder sind sämtlich ebenso ausgesprochen tiefstimmig wie seine epischen Werke, umgekehrt verträgt bei Walther von der Vogelweide selbst die wehmütige Elegie [64]
Owê war sint verswunden elliu mîniu jâr?
ist mir mîn leben getroumet oder ist ez wâr?
daz ich ie wânde daz iht waere, was daz iht?
im Zusammenhang keine tiefe Tonlage. Am deutlichsten sind diese Stimmunterschiede wohl gerade bei den ältesten deutschen Lyrikern ausgeprägt. Der Kürenberger, Meinloh von Sevelingen, Dietmar von Aist sind da z. B. gute Muster für konsequente Tieflage, während Friedrich von Hausen ein exquisites Beispiel für Hochlage liefert.
Das ist nun gewiß ein sehr befremdlicher Zustand, und wir vermögen vorläufig in keiner Weise zu erklären, warum es so ist und nicht anders. Aber die fortgesetzten Reaktionsproben geben so konstante Resultate im Sinne jener Stabilität, daß man sie nicht mit dem billigen Einwand beiseite schieben kann, man glaube nicht an die Erscheinung, weil man deren Gründe nicht kenne und weil a priori auch andere Zustände denkbar seien.
Lassen Sie mich nun auch auf diesem Gebiete die Anwendbarkeit des melodischen Kriteriums durch einige Beispiele illustrieren.
Ich beginne mit der formalen Textkritik.
Hier wird man nach dem Gesagten ohne weiteres den Satz aufstellen dürfen, daß es unzulässig ist, eine durch die Überlieferung gebotene Stabilität der melodischen Form durch die Einsetzung von Konjekturen zu zerstören. Das ist aber in unseren kritischen Ausgaben sehr häufig geschehen, weil man eben von dem Stabilitätsprinzip noch keine Kenntnis hatte. Auch hierfür nur ein Beispiel.
Bei dem bekannten Tagelied Dietmars von Aist verlangt der handschriftliche Text zunächst einige minimale Berichtigungen der Sprachform und eine ebenso selbstverständliche Wortumstellüng, um metrisch, lesbar zu sein. Dann ergibt sich folgendes melodisches Bild. Die Stimmlage bleibt durchgehende stabil, die Tonbewegung innerhalb der durch die Stimmlage gebotenen Grenzen ist ziemlich lebhaft: sie steht der dipodischen Bindung nahe und durchläuft nicht unbeträchtliche Intervalle. Alle Verse haben Tiefschluß:
'Slâfest du, friedel ziere?
wan wecket uns leider schiere,
ein vogellîn sô wol getân
daz ist der linden an daz zwî gegân.’
'Ich was vil sanfte entslâfen:
nu rüefestu kint Wâfen.
liep âne leit mac niht gesîn:
swaz du gebiutest, daz leiste ich, friundin mîn.’
Diu frouwe begunde weinen.
'du rîtest hinnen1 und lâst mich eine(n).
wenne wilt du wider her zuo mir?
owê du füerest mîn fröide samet dir.’
Ganz anders bei der Gestalt, in die der Text in Minnesangs Frühling gebracht ist. Da finden wir ein wunderliches Gemisch melodischer Gegensätze: [65] wo der handschriftliche Text gewahrt ist, behält er das alte Gepräge, aber alle abweichend konstituierten Zeilen sind gegenüber der mitteltiefen Stimmlage des übrigen unnatürlich in die Höhe getrieben; außerdem aber haben sie zum Teil die lebhaftere Stimmbewegung gegen eine einförmigere, mehr im Niveau bleibende Betonungsweise vertauscht und sämtlich wieder die sonst charakteristischen Tiefschlüsse verloren. Man urteile selbst:
'Slâfest du, mîn friedel?
wan wecket unsich leider schiere,
ein vogellîn sô wol getân
daz ist der linden an daz zwî gegân.’
'Ich was vil sanfte entslâfen:
nu rüefestu kint Wâfen wâfen.
liep âne leit mac niht gesîn:
swaz du gebiutst, daz leiste ich, friundîn mîn.’
Diu frouwe begunde weinen.
'du rîtest hinne7 und last mich einen.
wenne wilt du wider her?
owê du füerest mîne fröide dar.’
Wer kann hier daran zweifeln, daß mit der melodischen Form auch die ganze Stimmung des Liedes zerstört ist, und daß wir wieder zum überlieferten Text zu- rückkehren müssen?
Mindestens ebensoviel wie für die niedere leistet die Melodieprobe auch für die höhere Kritik, zumal in Echtheitsfragen.
Es ist von mir schon oben darauf hingewiesen worden, daß der mittelalterliche deutsche Dichter nur eine Durchschnittsstimmlage kennt, soweit es sich um Werke von unbezweifelter Echtheit handelt. Die Stabilität der Stimmlage geht aber fast allemal in die Brüche, wenn man zweifelhafte oder sicher untergeschobene Stücke zum Vergleich heranzieht. In Minnesangs Frühling schließt z. B. die Sammlung der Spervogelsprüche mit einer Strophe, zu der Haupt bemerkt: 'Diese altertümliche Strophe habe ich hier untergebracht, ohne großes Bedenken, aber auch ohne den Dichter verbürgen zu wollen.’ Sie beginnt mit den Worten:
Güsse schadet dem brunnen:
sam tuot dem rîfen diu sunne:
am tuot dem stoube der regen
und ist ausgesprochen hochstimmig. Alle gut bezeugten Sprüche des alten Spervogel aber, wie z. B.:
Ein wolf und ein witzic man
azten schâchzabel an:
si wurden spilnde umbe guot,
sind ebenso ausgesprochen tiefstimmig, und damit fällt die Berechtigung, jene erste Strophe auch nur vermutungsweise dem alten Spervogel zuzuschreiben.
Ein besonders willkommenes Hilfsmittel liefert uns die Melodieprobe da, [66] wo es gilt, die Arbeit von Nachahmern von den echten Werken eines Autors zu trennen. Ein glücklicher Zufall hat es nämlich so gefügt, daß gerade in der Tonlage die Nachahmer ihre Vorbilder fast nie zu kopieren verstanden haben, und oft auch in anderen Punkten der melodischen Technik nicht. So beginnt z. B. die kurze Verserzählung Von der halben Birne, die sich, wie wir jetzt wissen8, mit Unrecht als Werk Konrads von Würzburg bezeichnet, mit den Worten:
Hie vor ein rîcher künec was,
als ich von im geschriben las
der het ein wunneclîchez wîp
und eine tohter, der ir lîp
stuont ze wunsche garwe.
Der Melodietypus dieser Verse bleibt durch das ganze Gedicht: ziemlich tiefe Stimmlage und ausgesprochene Vorliebe für Tiefschluß. Dem stehen die über 100 000 echten Verse Konrads gegenüber, etwa mit diesem Typus:
Ein ritter und ein frouwe guot
diu heten leben unde muot
in ein ander sô verweben,
daz beide ir muot und ouch ir leben
ein dinc was worden also gar:
swaz der frouwen arges war, daz war ouch dem ritter.
Also hohe Stimmlage, überwiegender Hochschluß, und prägnanter Tiefschluß nur als Ruhepunkt beim Satzende.
Ebenso isoliert steht z. B. das sogenannte Zweite Büchlein den etwa 25000 echten Versen Hartmanns von Aue gegenüber. Hartmann ist überall Tief Stimmer mit ausgeprägter Vorliebe für Tiefschluß, daneben — von den lyrischen Gedichten ist hier abzusehen — ein Meister lebendiger Modulation. Ich greife, um das zu illustrieren, zum Vergleich ein, übrigens nicht einmal sehr charakteristisches Stück, den Schluß, aus dem sicher echten sogenannten Ersten Büchlein heraus. Es lautet:
'Ouch behalt du dînen glimph, nû sûme dich niht mêre:
daz sî in emest ode in schimph ich bevilh dir unser êre,
von dir daz wort iht verneme unser heil stêt an dir:
daz sî zeheime hazze neme, nû soltu, lîp, hin zir
und ervar ir willen swâ dû kanst, unser fürspreche sîn.’
ob dû dir saelde und heiles ganst. 'daz tuon ich gerne, herze mîn.'
Nun versuche man einmal, irgend einen Passus des Zweiten Büchleins nach diesem Muster zu lesen: es ist einfach unmöglich. Der Text treibt unwiderstehlich zu höherer Tonlage, zur Nivellierung der Tonschritte und zu typischem Hochschluß hin. Man vergleiche etwa diese Zeilen, ebenfalls aus dem Schlusse des Büchleins: [67]
'Kleinez büechel, swâ ich sî,
sô wone mîner frowen bî,
wis mîn zunge und mîn munt
unt tuo ir staete minne kunt,
daz sî doch wizze daz ir sî
mîn herze zallen zîten bî,
swie verre joch der lîp var.’
Auch für schwierigere und annoch schwebende Fragen der Kritik vermag die Melodieprobe reichlichen Gewinn abzuwerfen. Ich möchte es wenigstens nicht unausgesprochen lassen, daß z. B. auch auf die heiß umstrittene Nibelungenfrage von dieser Seite her ein unerwartetes und, wie ich glaube, entscheidendes Licht fällt. Aber das läßt sich ohne Eingehen auf vielerlei Details nicht klarlegen, auch sind meine Untersuchungen hier noch nicht zu genügendem Abschluß gelangt. Ich muß also die genauere Erörterung dieses Problems wie die mancher anderen hier eben nur gestreiften oder noch gar nicht be- rührten Frage einer späteren Gelegenheit Vorbehalten.9
Ich stehe am Ende meiner Betrachtungen. Wohl weiß ich, daß ich Ihnen nichts Abgeschlossenes habe bieten können, kaum mehr als den Ansatz zu einem Programm, dessen Ausführung noch viel geduldige Arbeit erfordern wird. Um so erfreulicher würde es mir sein, wenn Sie auch jetzt schon den Eindruck hätten gewinnen können, daß hier ein Weg angedeutet ist, den zu betreten der Mühe lohn.
1 Rede, gehalten bei der Übernahme des Rektorats und gedruckt in dem Universitätsprogramm zum Rektoratswechsel an der Universität Leipzig am 31. Oktober 1901, sowie in Ostwalds Annalen der Naturphilosophie I, 76 ff., und in Ilberg-Richters Neuen Jahrbüchern, Jahrgang 1902, I. Abt., IX. Band, S. 53ff. (die in [ ] beigefügten Seitenzahlen sind die dieses letzten Druckes).
2 Weimarer Ausgabe XXV, 66.
3 Am 25. Mai 1792. S. Schillers Briefe, herausgegeben von Fr. Jonas III, 202.
4 Ausgenommen hiervon sind nur gewisse mechanisch bedingte Spezialfälle, die mit der freien Melodisierung der Rede nichts zu tun haben. Über sie vgl. meine Grundzüge der Phonetik, 5. Aufl., Leipzig 1901, § 665.
5 Thüringen und Sachsen stehen z.B. im ganzen auf der Seite des süddeutschen Systems, aber durch Einfluß von Schule und Bühne sind bei den Gebildeten viele Kreuzungen entstanden, so daß es oft sehr schwer wird, reine Resultate zu erhalten.
6 Will man volle und reine Tonwirkung erzielen, so ist bei allen den folgenden Fauststellen der Wortlaut des Urfaust einzusetzen.
7 Wahrscheinlich ist hinne zu streichen und demnach du rîtest zu lesen.
8 S. K. Zwierzina, Zeitschrift für deutsches Altertum XLIII, 107 f.
der het ein wunneclîchez wîp und eine tohter, der ir lîp stuont ze wunsche garwe.
9 Eine eingehende Untersuchung der ganzen Frage gedenke ich in der Fortsetzung meiner 'Metrischen Studien' vorzulegen, deren erster Teil ('Studien zur hebräischen Musik') in den Abhandlungen der Kgl. Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften XXI, Nr. 1 u. 2 (Leipzig 1901) erschienen ist.