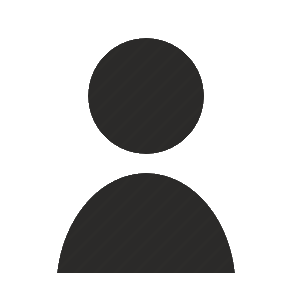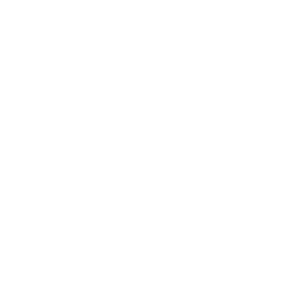This document is unfortunately not available for download at the moment.
Zur Rhythmik und Melodik des neuhochdeutschen Sprechverses
Eduard Sievers
pp. 97-114
1Wenn ich mir gestattet habe, mir Ihre Aufmerksamkeit für einige Bemerkungen zur neuhochdeutschen Metrik zu erbitten, so ist das nicht in dem Sinne geschehen, als ob ich Ihnen abgeschlossene Resultate eingehender Untersuchungen vorlegen könnte oder wollte. Meine Absicht ist es vielmehr nur gewesen, einige Gesichtspunkte zur Diskussion zu stellen, die sich mir bei meinen metrischen Arbeiten als wesentlich ergeben hatten, [371] die aber, soweit ich sehe, noch nicht überall in vollem Umfang anerkannt oder bei der Detailforschung praktisch verwertet worden waren, so vieles auch im einzelnen bereits ausgesprochen sein mag. Um es kurz zu sagen, ich möchte für eine Erweiterung des herkömmlichen Begriffs der Metrik plädieren, und zwar zunächst in ihrer Anwendung auf die modernen Literaturen, die allein eine solche Erweiterung auf Grund direkter Beobachtung gestatten. Erst wenn hier das Feld geebnet ist, wird man auch rückschließend auf ältere Perioden zurückgreifen können.
Zu diesem Zwecke bitte ich mir zunächst einige allgemeine Vorerörterungen gestatten zu wollen.
Ein jedes Kunstwerk, auch das poetische, wirkt zunächst in seiner Totalität als eine in sich geschlossene Einheit. Der Eindruck, den es hervorbringt, kann sehr mächtig sein, auch ohne daß der Genießende sich aller der einzelnen Faktoren getrennt bewußt wird, aus denen sich dieser Eindruck zusammensetzt. Aber ein volles Verständnis der Wirkung werden wir doch erst erreichen, wenn es uns gelingt, jene Gesamtwirkung zu zergliedern und dadurch auch zu lernen, jeden Einzelfaktor seinem Werte nach abzuschätzen und seine künstlerische Verschlingung mit den übrigen Faktoren zu verfolgen, mag es sich dabei um eine Wirkung in gleichem Sinne oder um Spiel und Widerspiel handeln.
Dem Metriker speziell fällt also die Aufgabe zu, den Anteil festzustellen und zu zergliedern, den die lautliche Kunstform der Poesie im Gegensatz zur Lautform der ungebundenen Rede an der eigentümlichen Wirkung des einzelnen Dichtwerks wie der Dichtung überhaupt hat. Damit ist denn zugleich gesagt, daß die altherkömmliche Auffassung der Metrik als der Lehre von den Zeitmaßen der gebundenen Rede viel zu eng und einseitig ist, und auch die Herbeiziehung der Betonungsschemata, wie sie in der deutschen Metrik auch jetzt noch geübt wird, reicht nicht aus, die Aufgaben der wissenschaftlichen Metrik vollständig zu lösen. Die Lehre von den Zeitmaßen wie von der Betonung der gebundenen Rede ist nur je ein Kapitel aus der Lehre voň der spezifischen Lautform der gebundenen Rede überhaupt. Die wissenschaftliche Metrik hat vielmehr alles in ihren Bereich zu ziehen, was dazu beiträgt, der Lautform der gebundenen Rede ihren Kunstcharakter zu verleihen, und jedes dieser Elemente muß sie auf seinen Wirkungswert hin prüfen. Es ist nicht anders als bei dem Kunstwerk selbst. Fällt bei diesem auch nur eines der den Kunstcharakter bedingenden Momente aus, so verliert das Kunstwerk den Charakter der Vollendung, durch den es andernfalls auf uns wirkte, und, entgeht ein solches Moment dem zergliedernden Theoretiker, so verliert er damit ein Mittel zum Verständnis eben jener Kunstwirkung, von der er Rechenschaft ablegen soll. Was bleibt von dem wohllautendsten Verse, von der formvollendetsten Dichtung an Wirkung übrig, wenn wir etwa, Form und Inhalt voneinander trennend, bloß das sog. metrische Schema herauspräparieren? Gewiß nicht mehr, als wenn man aus einem in blühender Schönheit strahlenden lebendigen Organismus das tote Knochengerüst herausschälen wollte.
Als oberstes Gesetz für den Metriker dürfen wir es danach wohl bezeichnen, daß er bei seiner Analyse der Form doch nie den Inhalt außer acht lasse, daß er nie mit bloßen Schemen operiere, sondern mit lebendigen Teilen des Kunstwerks selbst, dem diese Schemen zukommen. Mit andern Worten, es ist unzulässig, daß der Metriker die einzelnen Teile eines Dichtwerks, die sich etwa ohne Zerstörung seines Charakters ausscheiden lassen (also Verse, Strophenteile, ganze Strophen usw.), gewissermaßen aufbaue [372] aus den erst durch weitergehende Analyse zu gewinnenden abstrakten Einzelstücken, als da sind Silben, Versfüße und dergleichen. Sonst wird es auch von ihm heißen, daß er zwar die Fäden in der Hand habe, aber leider ihm das geistige Band fehle. Vielmehr wird der Metriker zu zeigen haben, wie das in sich geschlossene Kunstwerk weiterhin gegliedert ist, und wie gerade in der kunstvollen Gliederung und der kunstvollen Bindung der Glieder ein wesentliches Moment der Wirkung besteht.
Hierbei tritt nun eine eigentümliche Schwierigkeit gerade dem Metriker hemmend in den Weg. Das Werk des Malers oder Bildhauers wirkt direkt in der Gestalt, die ihm sein Urheber gegeben hat: es ist sozusagen authentisch überliefert und kann von jedem Beschauer in dieser seiner authentischen Gestalt genossen und geprüft werden. Anders beim Dichtwerk. Nur selten wird der Genießende wie der Theoretiker in der glücklichen Lage sein, ein solches Werk in der Gestalt in sich aufzunehmen, wie es aus dem Munde des Dichters selbst quillt, der, getragen von einer beherrschenden Stimmung, dieser Stimmung selbst, dem innern Drange folgend, unwillkürlich den beredtesten Ausdruck verleiht, Vorausgesetzt, daß auch der Dichter selbst imstande ist, der innern Stimme mit seinen Ausdrucksmitteln gerecht zu werden. In der Regel wirkt das Dichtwerk durch eine schriftliche Überlieferung hindurch, die doch nur als ein kümmerliches Surrogat für das lebendige Wort gelten kann. Um voll wirken zu können, muß das in der Schrift erstarrte Dichtwerk erst durch mündliche Interpretation, durch Vortrag wieder ins Leben zurückgerufen werden. Das kann aber nicht anders geschehen, als indem der Vortragende sich zunächst in Inhalt und Stimmung der Dichtung so versetzt, daß sie in ihm, wie einst in ihrem Urheber, wieder lebendig wird, daß er von ihr so ergriffen wird, als ob er sie im Augenblick aus eigener Stimmung heraus selbst erzeugte. Und so ist es nicht unrichtig, wenn man sagt, daß ein guter Vortrag, eine gute Aufführung der beste Kommentar zu einer Dichtung sei.
Aber gerade in diesem gut liegt die Schwierigkeit. Die Stimme des Dichters ist verklungen: er kann nicht mehr dem Vortragenden Weisungen darüber geben, wie er dies oder jenes verstanden oder empfunden habe. Subjektive Nachempfindung und Nachbildung muß also die Stelle der direkten Anregung vertreten, und dabei sind Fehlgriffe kaum zu vermeiden, zumal ja die ausdruckslose Schrift gar oft zu verschiedenartigen Deutungen und Auffassungen derselben Stelle Anlaß gehen kann. Zum Glücke aber sind wir doch in der Lage, ein weitreichendes Mittel zur Korrektur solcher Fehlgriffe im Experiment zu haben, indem wir verschiedene Interpretationen einer solchen mehrdeutigen Stelle uns vorführen: denn es kann keinem Zweifel unterliegen, daß diejenige lautliche Interpretation das Richtige trifft, von welcher die vollste und zugleich reinste, d. h. angemessenste Wirkung auf den prüfenden Hörer ausgeht.
Ich meine hiernach, man habe ein gutes Recht, an den Metriker die Forderung zu stellen, daß er selbst erst richtig vortragen lerne, ehe er seine theoretische Zergliederung beginnt. Nur dann wird er auch erfolgreich Metrik lehren können, wenn er selbst bis zu einem gewissen Grade sich zum Künstler im Vortrag emporgearbeitet hat. Gewiß kann er das zu einem Teile durch instinktives Hineinleben und Hineinfühlen in den 'Geist' der Dichtung: aber klarer und bewußter wird er sein Ziel erreichen, wenn er auch der Theorie nicht fremd bleibt.2
Fassen wir diese Erwägungen kurz zusammen, so ergibt sich, daß für die Metrik, [373] d.h. die Einführung in die Formeigenheiten und Formschönheiten der Dichtung, gerade diejenigen Teile der Gesamtdisziplin im Vordergrunde stehen müssen, die für das Verständnis der Formwirkung der Dichtung hauptsächlich maßgebend sind. Das sind aber nicht sowohl die üblichen Vers- und Strophenschemata (sobald man sich wenigstens ihres spezifischen Ethos nicht bewußt wird), als vielmehr gewisse mehr allgemeine Eigenheiten der gebundenen Rede.
Um diese allgemeinen Eigenschaften richtig ausscheiden und beurteilen zu können, wird man am sichersten den Weg der historischen Betrachtung einschlagen. Und zwar hat man von dem wohl zweifellos feststehenden Satz auszugehen, daß alle Dichtung ursprünglich Gesang war, und zwar vermutlich Gesang begleitet von Tanz, d.h. rhythmischen Bewegungen des Körpers. Ja man kann vielleicht so weit gehen, zu sagen, daß die gebundene Rede überhaupt dadurch entstand, daß man die Rede den rhythmischen Tanzbewegungen anzupassen suchte. An der Hand von Tanz und Gesang, dann weiter an der Hand des Gesanges allein haben sich die spezifischen Formen der gebundenen Rede entwickelt. Der Gesang aber ist wieder nur eine besondere Art der Musik, und seine Formen sind die allgemeinen Formen der Musik: nur das Instrument ist verschieden.
Ein fertiges Musikstück aber setzt sich aus zwei wesentlich verschiedenen Elementen zusammen, aus Rhythmus und Melodie; wenigstens ist das die Regel, die durch einzelne Ausnahmen (wie etwa die bloß rhythmische Musik der Trommel oder die bloß melodische Musik der Orgel) nicht gestört wird.
Die Bildung der Melodien unterliegt in den verschiedenen Zeiten und bei den verschiedenen Völkern den mannigfaltigsten Modifikationen: für sie lassen sich also allgemeine Regeln kaum aufstellen. Die Grundgesetze des Rhythmus aber sind für alle Zeiten dieselben gewesen und werden ewig dieselben sein: nur die spezielle Füllung der einzelnen Grundformen kann dem Wechsel unterliegen. Im Rhythmus selbst aber verschlingen sich wieder zwei Elemente: Zeit und Kraft (oder Nachdruck), d. h. der (musikalische) Rhythmus verlangt einerseits die Zerlegung des Tonwerks in bestimmte Zeitabschnitte (wie sie z. B. die Takte unserer Musik darbieten) und deren weitere Gliederung nach einer bestimmten Anzahl primärer Zeiteinheiten (der χρόνοι πρϖτοι der griechischen Terminologie), andrerseits eine dynamische Abstufung der Lautmassen gegeneinander, die zur Füllung der einzelnen Zeitteile dienen.
Alle diese Elemente finden sich auch im Gesang wieder, so gut wie in der Instrumentalmusik. Aber die Dichtung bleibt nicht immer Gesang: sie befreit sich von den Fesseln der Gesangsmelodie und des spezifischen Gesangsrhythmus: neben den Gesang tritt die gesprochene Dichtung, neben den Gesangsvers der Sprechvers. Für große Gebiete der Dichtung, zumal für Epos und Drama, wird der Sprechvortrag zur Norm, und so wendet sich die Tätigkeit des Metrikers schließlich vorzugsweise dem Sprechvers zu, indem er die Pflege und Theorie des Gesangsvortrags mehr oder weniger dem Musiktheoretiker und Musiklehrer überläßt.
Nun möchte es auf den ersten Blick scheinen, als sei Gesang und Sprechvortrag etwas toto genere Verschiedenes. Und in der Tat ist ihr Abstand sehr beträchtlich. Aber es ist doch nur ein Gradunterschied, kein Wesensunterschied. Auch der Sprechvers hat Rhythmus und Melodie (nur sind sie andrer Art als im Gesang). Ja Rhythmus und Melodie sind für den Sprechvers ebenso wesentlich wie für den Gesang: sie verleihen [374] auch ihm sein charakteristisches Gepräge. Nur dann erst kann auch der Sprechvers für vollständig analysiert gelten, wenn sein rhythmischer wie sein melodischer Gang richtig erfaßt ist. Es ist also eine der ersten Aufgaben des Metrikers, sich die prinzipiellen Unterschiede sowohl wie das Gemeinsame zwischen Gesangs- und Sprechvers klar zu machen.
Wie verhält sich der Rhythmus des gesprochenen Verses zum Gesangsrhythmus? Um diese erste Frage richtig beantworten zu können, muß man sich zunächst von den überlieferten Vorstellungen freimachen, die aus der hergebrachten Bezeichnungsweise des sog. musikalischen Taktes geflossen sind. Unser Taktstrich scheidet im Prinzip weder rhythmische noch melodische Teilstücke aus; er dient also weder der rhythmischen noch der melodischen Gliederung, sondern nur der abstrakten Zeitmessung, indem er die Zeiteinheiten zählt und ordnet, die von Hebung zu Hebung verfließen (er ist nur ein praktisches Hilfsmittel für richtige Zeiteinhaltung beim Vortrag). Eine rhythmische oder melodische Gruppe oder Figur aber entsteht dadurch, daß man eine Reihe von Einzelschällen (Noten bzw. Gesangssilben) dadurch zu einer höheren Einheit bindet, daß man sie mit einem gemeinschaftlichen Willensimpuls hervorbringt. Das Ein- und Absetzen dieser Impulse scheidet die einzelnen Gruppen voneinander. Natürlich kann eine solche Grenze auch dahin fallen, wo wir den Taktstrich setzen, d. h. unmittelbar vor eine Hebung; aber das ist auch nur ein möglicher Fall. Ebensogut wie mit einer Hebung kann eine rhythmische oder melodische Gruppe auch mit einer oder mehreren Senkungssilben beginnen, und ebenso frei ist auch der Schluß. Mit andern Worten: die Hebung kann ebensowohl zu Eingang einer Rhythmusgruppe stehen (wir sprechen dann von fallendem Rhythmus), oder zu Schluß (steigender Rhythmus), oder in der Mitte (fallend-steigender Rhythmus). Wir werden somit auf die antike Unterscheidung von rhythmisch gegensätzlichen Versfüßen wie Daktylus ´ ͜͜ ͜ Anapäst ͜ ͜ ´ und Amphibrachys ͜͜ ´ ͜ oder von Trochäus ´ ͜͜ und Iambus ͜͜ ´ als die vollkommenere Art der Rhythmenbezeichnung zurückgeführt. In ihnen ist die eigentliche rhythmische Bindung gleich mitbezeichnet, während unser Taktstrichsystem alle numerisch gleichen Rhythmusgruppen unterschiedslos zusammenfallen läßt, also die vierzeitigen Daktylen, Anapästen und Amphibrachen im 4/4-, die dreizeitigen Trochäen und Iamben im 3/8- (oder halben 6/8-) Takt zusammenwirft, oder die sechszeitigen Ionici a maiore ´ ͜͜ ͜ und a minore maiore ͜͜ ͜ ´ im 3/4-Takt. Richtig ist dabei allerdings, daß diese verschiedenen Rhythmusformen bei numerischer Gleichheit innerhalb ein und desselben Musikstücks ineinander übergeführt werden können, d. h. daß bei gleichmäßig durchlaufender Zeitteilung die Bindung wechseln kann. Freilich wird dieser Rhythmuswechsel in der Instrumentalmusik, wo die äußeren Kriterien für Bindung und Nichtbindung nicht so deutlich sind, oft vernachlässigt; aber im Gesang, wo die Rhythmengruppen mehr oder weniger mit Sinnesgruppen zusammenfallen, wird er — wenn auch unbewußt — mit größter Sicherheit zum Ausdruck gebracht. Ja, hier ist der Rhythmuswechsel geradezu ein sehr beliebtes Mittel der Variation, und besonders gern wird der Schlußzeile einer Strophe ein abweichender Rhythmus gegeben, um den Abschluß der Periode zu bezeichnen. Einen Wechsel von drei steigenden und einer fallenden Reihe zeigt z. B. das Studentenlied Es sá- | ßen beim schä´u- | menden, fún- | kelnden Wéin || drei froh- | liche Búr- | sche und sán- | gén; (p) || es schm- | te und bráus- | te das Jú- | bellíed, || und | lústig die | Bécher er- | klán- | gén, dreifachen Wechsel (steigend, steigend-fallend, fallend) das Lied An den Rhéin, | an den Rhéin, | zieh’ nícht | an den Rhéin, || mein [375] Sóhn, | ich rá- | te dir gut; || da géht dir | das Lében | zu líeb- | lich éin, || da | blüht dir zu | fréudig der | Mut. ||
Die verschiedene Bindung ändert hierbei — und das ist für den Charakter der verschiedenen Rhythmusgruppen sehr wesentlich — nicht nur die Gruppierung der Zeiteinheiten bzw. der zu ihrer Ausfüllung dienenden Schälle, sondern auch deren dynamisches Verhältnis zueinander. Ein fallender Takt ist durchgehends fallend, d. h. es nimmt auch die Hebung, zumal wenn sie auf eine lange Note fällt, an dem allgemeinen Decrescendo teil, sie geht also weicher, verklingend aus. Umgekehrt beim steigenden oder Crescendo-Takt: hier bleibt die Hebung bis zu ihrem Schluß mindestens auf gleicher Stärkestufe stehen, sie hebt sich dadurch kräftiger von der folgenden Senkung ab, und sie neigt besonders gern zur Überdehnung (man vgl. z.B. den Umschlag in
E | QI | E | Q | QI | E | Q | QI | E | Q | W |
Es | sa - | ßen | beim | schäu- | men- | den, | fun- | keln- | den | Wein |
Q | QI | E | Q | QI | E | Q | WI | Q | A | S |
Drei | fröh - | li - | che | Bur - | sche | und | san - | gen; | ||
E | QI | E | Q | QI | E | Q | QI | E | W | |
es | schall- | te | und | braus - | te | das | Ju - | bel - | lied, | |
Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | WI | Q | ||
und | lus- | tig | die | Be- | cher | er - | klan - | gen, |
wo die Hebungen der steigenden Reihen auf QI gebracht sind, während die fallende Schlußzeile nur QI Hebungen besitzt).
Daß sich hiernach ein wesentlicher Unterschied zwischen einem Auftakt, d.h. einer unbetonten Silbe oder Note, die ungebunden einer Rhythmusgruppe vorausgeht, und einer Eingangssenkung, d.h. einer gebundenen Senkungssilbe zu Eingang einer Rhythmusgruppe, ergibt, ist selbstverständlich. So sind die Eingangssilben der drei ersten Zeilen unseres Beispiels Eingangssenkungen, das und zu Eingang der letzten Zeile aber echter Auftakt (man kann oft beobachten, wie gerade hinter diesem und eine Atempause gemacht wird).
Alle diese Erscheinungen des Rhythmuswechsels begegnen auch im Sprechvers, ja sie treten hier häufiger und in größerer Mannigfaltigkeit ein als beim Gesang, weil hier beim Fortfall der strengeren Melodie der Text leichter und stärker in Sinnesgruppen auseinanderfällt, die ihrerseits wieder die Basis für die Rhythmusgruppen bilden. Dabei ergeben sich wieder charakteristische Verschiedenheiten je nach der Stelle, wo der Rhythmuswechsel eintritt.
Innerhalb eines einheitlichen Versstückes wird der Rhythmuswechsel jetzt selten angewandt. Ein deutliches Beispiel aber, das einen besondern Effekt erzielen will, ist der heutige Choliambe, vgl. z. B. Schlegels Verse:
Der Choliambe scheint ein Vers für Kunst- | richter, Die immerfort voll Naseweisheit mit- | sprechen Und eins nur wissen sollten: daß sie nichts | wissen. [376] |
Dagegen ist er ohne weiteres gestattet zwischen Vers und Vers. Ein hübsches Beispiel für malenden Gebrauch dieses Wechsels bietet Bürgers Lied vom braven Mann:
Der | Tauwind | kam vom | Mittags- | meer Und | schnob durch | Welschland | trüb und | feucht Die | Wolken | flogen | vor ihm | her, Wie | wann der | Wolf die | Herde | scheucht. Er fegte | die Felder, | zerbrach | den Forst, Auf | Seen und | Strömen das | Grundeis | borst. |
Erlaubt und oft besonders wirkungsvoll ist aber auch der Wechsel des Rhythmus in der Zäsur. Wie prächtig hebt sich z. B. das Crescendo-Decrescendo der Verse mit weiblicher Zäsur von dem gleichlaufenden Rhythmus der Zeilen mit männlicher Zäsur in den Worten der Iphigenie ab:
Wie in der Göttin | stilles Heiligtum, Tret’ ich noch jetzt mit schauderndem Gefühl, Als wenn ich sie zum erstenmal beträte, Und es gewöhnt sich nicht mein Geist hierher. Heraus in eure Schatten, | rege Wipfel Des alten, heil’gen, | dichtbelaubten Haines, |
Ein zweiter wichtiger Punkt betrifft den Umfang und etwaige innere Gliederung der Gruppen. Wie die Musik einfache und zusammengesetzte Takte unterscheidet, so- muß dies auch die Rhythmik des Sprech- verses tun. Der zusammengesetzte Takt der Musik entsteht aber dadurch, daß man je zwei (seltener mehr) einfache Takte durch Unterordnung des einen unter den andern zu einer höheren Einheit zusammenfaßt (so besteht z. B. der 6/8- aus zwei 3/8-Takten, von denen einer dominiert). Koordiniert sind dann nicht die einfachen Takte oder deren Hebungen, sondern die zusammengesetzten Takte oder Taktgruppen und deren Hebungen. Ebenso sind beim Sprechvers einfache und zusammengesetzte oder monopodische (oder podische) und dipodische Bindung zu unterscheiden. Im podischen Vers sind alle einfachen Rhythmusgruppen oder 'Füße' (wie wir nun sagen können) im Prinzip koordiniert, ihr Nachdruck wechselt daher nicht nach bestimmten rhythmischen Verhältnissen, sondern lediglich nach den etwaigen Abstufungen des Sinnesakzents; im dipodischen Vers sind je zwei Füße derart zu einer Einheit verbunden, daß der eine dem andern im Nachdruck untergeordnet ist. Man vergleiche etwa Verse wie
Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn, Im dunkeln Laub die Goldorangen glühn, Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht, Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht? |
mit solchen wie
Sah ein Knab’ ein Röslein stehn, Röslein auf der Heiden, War so jung und morgenschön, Lief er schnell es nah zu sehn, Sah’s mit vielen Freuden, |
oder
Als ich noch ein Knabe war, Sperrte man mich ein, Und so sah ich manches Jahr Über mir allein, Wie in Mutterleib. [377] |
Man kann hier zugleich deutlich beobachten, wie hier, bei der rhythmischen Dipodie, die minder betonten Füße auch an Zeitmaß hinter den voll betonten zurücktreten, die sich auf ihre Kosten etwas ausdehnen.
Besonders auffällig ist ferner in den Versen dipo- discher Bindung die Häufigkeit und Leichtigkeit des Rhythmuswechsels, d. h. der Wechsel und die Bindung von steigenden und fallenden Dipodien. Man wird gut tun, diesen Wechsel auch technisch zu bezeichnen, also etwa Verse mit gleichlaufendem oder gebrochenem Rhythmus zu unterscheiden (Beispiele: gleichlaufend áls ich nòch ein | Knábe wàr, gebrochen sàh ein Knáb’ ein Rö´slein stehn u. dgl.). Hierin ist der Sprechvers mannigfaltiger als der Gesangsvers, dem die auch rhythmisch feststehende Melodie an korrespondierenden Stellen gleichen Rhythmusgang vorschreibt, während der Sprechvers ohne Zwang den natürlichen Abstufungen des Sinnesakzents folgen kann, da der rhythmische Charakter jedes Einzelfußes gewahrt wird.
Wie man sieht, hängt die verschiedene Art der Bindung im Sprechvers wesentlich vom Sinnesakzent ab, und darauf beruht nun wiederum zum großen Teil die ganz verschiedene Wirkung podischer und dipodischer Verse. Ein podischer Vers kann doppelt soviel gleichgewichtiger Wörter enthalten als ein dipodischer Vers von gleicher Hebungszahl, und da kein Fuß hinter dem andern weder an Nachdruck noch an Zeitdauer zurückzubleiben braucht, kann der Vortrag bei jeder sinnvollen Hebung gleichmäßig verweilen, um deren Bedeutungsinhalt voll auf den Hörer wirken zu lassen. Dem dipodischen Vers haftet immer eine gewisse Leichtigkeit an, da die Hälfte seiner Füße mit relativ bedeutungslosem Wortmaterial angefüllt sein muß. Der podische Vers kann zwar bei entsprechender Wortwahl auch dieselbe Leichtigkeit erreichen, aber ebensogut eignet er sich zum Ausdruck schwerster Gedankenfülle, und so ist es nicht zum Verwundern, wenn gerade er unser eigentlicher Kunstvers geworden ist im Gegensatz zum dipodischen Vers, der die gesamte eigentliche Volksdichtung beherrscht.
Machte sich schon hier ein merklicher Gegensatz zwischen Gesangs- und Sprechvers geltend, so ist nun noch eines Punktes der Rhythmik zu gedenken, in dem der Sprechvers dem Gesangsvers diametral gegenübersteht: der Zeitaufteilung innerhalb der rhythmischen Gruppe. Der musikalische Takt bzw. die Rhythmusgruppe im Gesang baut sich aus einer bestimmten Anzahl ideeller Zeiteinheiten oder χρόνοι πρϖτοι auf, die man beim Taktschlagen oder Taktzählen einzeln markieren kann; solcher Zeiteinheiten hat z. B. der Tripeltakt drei, der Quadrupeltakt vier usw. Der Gesangsvers hat also eine ausgesprochene Doppelteilung der Zeit, in Takte und χρόνοι πρϖτοι innerhalb derselben. Der Sprechvers kennt nur die Fußteilung: innerhalb der Füße ist die Zeitteilung frei, sie richtet sich nach den natürlichen Quantitäten der einzelnen Silben (die wieder mannigfach variiert sein kann je nach Nachdruck und Betonung) und deren Anzahl. In andern Worten: der Sprechvers hat keinen χρόνος πρϖτος oder, was dasselbe ist, keine bestimmte Taktart, die sich durch eine Vorzeichnung ausdrücken ließe. Diese tritt allemal erst dann ein, wenn ein Sprechvers durch Komposition auf eine bestimmte Taktart gebracht wird.
So einleuchtend dieser Unterschied ist, so lange hat es gedauert, bis inan sich seiner deutlich bewußt wurde. Wie lange hat man nicht versucht, den alten Gesangsdaktylus (also einen Viervierteltakt) durch ein künstliches System ausgeklügelter Längen und Kürzen schematisch nachzuahmen, da doch für den Sprechvers das alte, nur für den [378] Gesang bestimmte Verhältnis von Länge und Kürze (d.h. einer 1/4 - und zwei 1/8 -Noten) fast gänzlich irrelevant ist! Will man den Sprechdaktylus, d. h. den Vers mit vorwiegend dreisilbigen Füßen, überhaupt einem Gesangsfuß vergleichen, so kann man ihn höchstens als einen aufgelösten Tripeltakt (Tribrachys ͜´ ͜ ͜ statt Trochäus ´ ͜ ) mit freier Verschiebung der Quantitäten bezeichnen, d.h. er nähert sich dem ungeraden Takt. Umgekehrt vergleichen sich die Verse mit vorwiegend zweisilbigen Sprechfüßen, also die sog. Iamben und. Trochäen, denen im Gesang von Haus aus der ungerade Tripeltakt zukam, nun eher dem geraden (zwei- oder vierzeitigen) Takt, sofern man überhaupt die freien Quantitäten des Sprechverses den xpövot irpuuToi der Musik zur Seite stellen kann.
Wie aber steht es mit der Melodie des Sprechverses? Zwei Hauptunterschiede fallen sofort ins Auge: dem Sprechvers fehlen die festen Töne des Gesangs (er ersetzt sie, wie die ungebundene Rede, durch Gleittöne in freiestem Wechsel), und es fehlen ihm die festen Melodien mit gleichmäßiger Wiederholung an korrespondierenden Stellen. In letzterer Beziehung ist, wie man sieht, der Sprechvers freier als der Gesangsvers; er ist aber zugleich stärker gebunden als dieser, insofern der einzelnen Silbe nicht wie in der Komposition eine wesentlich frei zu wählende Tonhöhe zukommt, sondern diejenige Tonhöhe, welche ihr nach dem Sinnes- und Stimmungsakzent der betreffenden Stelle oder, kürzer gesagt, nach dem natürlichen sprachlichen Satzakzent an sich eigen ist. Der Komponist bildet also seine Melodie fest nach frei gegebenen Tonhöhen und Intervallen, dem Dichter des Sprechverses stehen nur die festen Tonhöhen und Intervalle der empirischen Sprache zu Gebote, aber über diese kann er auch um so freier verfügen. Das ist aber um so wichtiger für die Ausdrucksfähigkeit des Sprechverses, als in der freien Rede gerade Wechsel der Stimmlage einerseits und Wechsel der Intervallgröße andrerseits zum Ausdruck verschiedenartiger Stimmung dienen. Die übrigen Mittel der Variation, wie Wechsel der Stimmqualität, des Tempos, von Forte und Piano usw. besitzt er ebenso wie der Komponist: durch die freie Verfügung über jene andern Mittel aber ist er ihm überlegen, d. h. er kann überall und ohne Schwierigkeit (wenn wir von der spezifischen Wirkung des Gesangs als solcher absehen) denselben Zusammengang von Sinn und Form erzeugen, den der Komponist nur etwa bei der Durchkomponierung eines Liedes erreichen kann. Daß freilich, je größer der Reichtum an Mitteln für die Variation des Ausdrucks ist, um so größer auch die Schwierigkeiten für den subjektiven Nachinterpreten werden, braucht nicht erst gesagt zu werden.
Hängt nun, wie wir gesehen haben, die Melodie- führung des Sprechverses von dem melodischen Teil des Satz- oder Sinnesakzentes ab, so ist andrerseits in Literaturen, die, wie die germanischen, 'akzentuierende Verse' bauen, d. h. einen Zusammenfall von Sinnesakzent und Versbetonung verlangen, auch der Rhythmus wesentlich an den Satz- oder Sinnesakzent gebunden, insbesondere nach der dynamischen Seite hin. Und darin liegt eine neue Quelle der Formschönheit: denn die vollendetste Wirkung muß doch da erzielt werden, wo das, was dem Sinne nach hervortreten muß, auch im Verse an hervorragender Stelle erscheint, und umgekehrt. Zugleich aber bietet der im Deutschen stark hervortretende Parallelismus zwischen Satzmelodie und dynamischer Satzbetonung uns ein Mittel dar, die verschiedenen Hauptarten der Melodieführung im Sprechvers in Anknüpfung an die oben geschilderten rhythmischen Hauptarten der Versbildung zu klassifizieren. Insbesondere kommt dabei der altbekannte Satz zur Anwendung, daß in [379] der mustergültigen deutschen Aussprache die Starktonsilben höher in der Skala zu liegen pflegen als schwächere. Andrerseits hat man sich daran zu erinnern, daß Abstufungen des Nach- drucks und der Dauer (also allgemein gesagt: rhythmische Abstufungen) in derselben Weise an den Verstand appellieren wie melodische Abstufungen (einschließlich des Wechsels der Stimmqualität) an Empfindung und Stimmung, dergestalt, daß Abstände des Nachdrucks und der Dauer geradezu als das Maß für logische oder gedankliche, Abstände der Intervalle als das Maß für Empfindungswerte bezeichnet werden können. Das im einzelnen endlos wechselnde Mischungsverhältnis von Verstand und Empfindung, das unsere Rede beherrscht, bringt daher auch im Sprechvers unendlich wechselnde, reizvolle Verschlingungen von rhythmischer und melodischer Abstufung hervor.
Aus dem Gesagten ergibt sich ohne weiteres, daß die dipodischen Verse in melodischer Beziehung einförmiger sein müssen als die podischen, da im allgemeinen wenigstens jeweilen der schwächere Fuß der Dipodie auch musikalisch tiefer liegt als der stärkere (vgl. wieder Beispiele wie áls ich nòch ein Knábe wàr oder sàh ein Knáb’ ein Rö´slein stèhn, oben S. 46).
Schwieriger ist es, die größere Mannigfaltigkeit der melodischen Formen der podischen Verse annähernd in ein System zu bringen. Aber wenigstens einige ausgeprägte Haupttypen lassen sich doch unterscheiden, an denen dann die Misch- und Übergangsförmen gemessen werden können.
Ich stelle voran Verse mit mehr oder weniger vollständiger Durchführung des Prinzips der Gleichberechtigung der einzelnen Füße auch in melodischer Beziehung. Die Füße sind dann nicht nur prinzipiell, sondern auch faktisch koordiniert (gelegentliche Ausnahmen ohne weiteres zugegeben). Die sinnvolleren Hebungen haben bei annähernd gleicher Tonstärke auch annähernd gleiche Tonhöhe. Das Ganze hat dabei wesentlich getragenen Charakter. Vgl. etwa Goethes Zueignung:
Der Morgen˰ kam˰; es scheuchten˰ seine˰ Tritte Den leisen˰ Schlaf˰, der mich gelind˰ umfing, Daß ich˰, erwacht˰, aus meiner˰ stillen˰ Hütte Den Berg hinauf˰ mit frischer Seele˰ ging. Ich freute mich˰ bei einem jeden Schritte Der neuen˰ Blume˰, die voll Tropfen˰ hing; Der junge Tag˰ erhob sich˰ mit Entzücken, Und alles˰ war erquickt˰, mich zu erquicken. |
Platen, Grab im Busento:
Nächtlich am Busento lispeln bei Cosenza dumpfe Lieder, Aus den Wassern schallt es Antwort, und in Wirbeln klingt es wieder! Und den Fluß hinauf, hinunter ziehn die Schatten tapfrer Goten, Die den Alarich beweinen, ihres Volkes besten Toten. |
Diesen melodisch gleichschwebenden Versen treten gegenüber Verse mit stärkerem, doch ungeordnetem Wechsel von Nachdruck und Tonhöhe. Als erstes Beispiel möge dienen Goethes Neue Liebe, neues Leben:
Herz, mein Hérz, was soll das gében? Was bedrä´nget dich so sehr? Welch ein frémdes, néues Lében! Ich erkénne dich nicht mehr! [380] Wég ist alles, was du liebtest, Wég, warum du dich betrübtest, Wég dein Fléih und deine Rúh — Ách, wie kámst du núr dazú? |
Charakteristisch für diese Art podischer Verse ist also die Regellosigkeit in der Stellung und Zahl der stärksten und höchsten Ikten. Zwei Formen aber heben sich aus der großen Fülle der Möglichkeiten noch etwa gesondert hervor.
Die erste, regelloseste Art möchte ich als Verse mit Sprungikten bezeichnen, d.h. Verse, in denen einzelne Ikten sich sprunghaft über das sonstige Niveau des Verses hinaus erheben. Am schärfsten prägt sich der Charakter dieser Verse aus, wenn nur ein solcher Sprungiktus darin enthalten ist. Vgl. etwa aus dem Faust:
Weh, steck’ ich in dem Kérker noch? Verflúchtes, dumpfes Mauerloch, Wo selbst das liebe Himmelslicht Trü´b durch gemalte Scheiben bricht! Beschrankt von diesem Bü´cherhauf, Den Wü´rmer nagen, Stáub bedeckt, Den bis ans hohe Gewö´lb hinauf E in angeraucht Papier umsteckt; Mit Glä´sern, Bü´chsen rings umstellt, Mit Instruménten vollgepfropft, Urväter Háusrat drein gestopft: Das ist deine Wélt, das heißt eine Wélt. |
Einen bestimmten Gegensatz hierzu bildet eine Vers- art, die ich als Skalen verse bezeichnen möchte. Hier steigt der Vers in Nachdruck wie in Tonhöhe stufenweis, in kleinen Intervallen zu einem Höhepunkt auf oder von ihm herab oder verbindet beides. Vgl. z. B. Goethes Vorklage :
Wie nimmt ein leidenschaftlich Stammeln Geschrieben sich so seltsam aus! Nun soll ich gar von Haus zu Haus Die losen Blätter alle sammeln. Was eine länge, weite Strecke Im Lében voneinander stand, Das kommt nun unter éiner Décke Dem guten Leser in die Hand |
usw. Ein schönes Beispiel für die Kontrastwirkung dieser beiden Versarten bietet der erste Dialog zwischen Wagner und Faust, in dem Wagner Skalenverse, Faust aber solche mit Sprungikten spricht:
Wagner: | Verzeiht, ich hört’ euch deklamieren: Ihr last gewiß ein griechisch Trauerspiel? In dieser Kunst möcht’ ich was profitieren, Denn heutzutage wirkt das viel. Ich hab’ es öfters rühmen hören, Ein Komödiant könnt’ einen Pfarrer lehren. |
Faust: | Ja, wenn der Pfarrer ein Komödiant ist, Wie das denn wohl zuzeiten kömmen mag. |
Wagner: | Ach! wenn man so in sein Museum gebannt ist Und sieht die Welt kaum einen Feiertag, Kaum durch ein Fernglas, nur von weiten, Wie soll man sie durch Überredung leiten? [381] |
Faust: | Wenn ihr’s nicht fü´hlt, ihr werdet’s nicht erjágen, Wenn es nicht aus der Seele dringt Und mit urkrä´ftigem Behagen Die Herzen aller Hörer zwingt. Sitzt ihr nur immer! leimt zusammen, Braut ein Ragout von andrer Schmaus Und blast die kümmerlichen Flammen Aus eurem Äschenhäufchen ’raus! Bewúndrung von Kindern und Äffen, Wenn euch darnach der Gaumen steht; Doch werdet ihr nie Hérz zu Hérzen schaffen, Wenn es euch nicht von Herzen geht! |
Endlich möchte ich noch auf eine eigentümliche Versart aufmerksam machen, die der Melodie nach di- podisch gebaut ist, d. h. je eine höhere und eine tiefere Note miteinander bindet, aber doch von der rhythmischen Dipodie (oben S. 46 f.) deutlich geschieden ist. Sie entsteht da, wo die schwächeren Hebungen, die in regelmäßiger Gruppierung mit stärkeren Hebungen paarweise gebunden sind, mindestens zum größeren Teile auf sinnvollere Wörter fallen. Gerade wegen dieser Bedeutungsfülle werden sie in Nachdruck und Dauer nicht so gemindert als in der rhythmischen Dipodie. Auch die schwächeren Hebungen und Füße müssen voll ausklingen, weil der Inhalt der Fußgruppe wegen der zwei sinnvollen Wörter, die in sie hineinfallen, auch als zweiteilig empfunden wird. Ein gutes Beispiel gewährt Goethes Fischer:
Das Wàsser ráuscht’, das Wàsser schwóll, Ein Físcher sáß daràn, Sàh nach dem Ángel rúhevöll, Kü`hl bis ans Hérz hinàn. Und wie er sítzt und wìe er láuscht, Tèilt sich die Flút empòr: Àus dem bewégten Wásser ràuscht Ein fèuchtes Wéib hervòr. |
Betonung und Quantitierung nach dem Schema der volksmäßigen rhythmischen Dipodie wäre hier geradezu abscheulich. Ein passender Name für diese Versart wird freilich schwer zu finden sein: melodische Dipodie genügt nicht ganz, das wirkliche Verhältnis auszudrücken, und so mag man sich vielleicht vorderhand mit dem rein äußerlichen Gegensatz von leichter und schwerer Dipodie begnügen.
Zum Schlusse noch eines. Es wird sich Ihnen bei den eben gegebenen Ausführungen die Frage aufgedrängt haben, ob die aufgestellten Unterschiede nicht rein zufälliger Natur sind, ob sie wirklich einer mehr oder weniger bewußten Intention des Dichters ihren Ursprung verdanken. Manches ist sicher nur Zufall, und von einem bewußten Schaffen der rhythmischen und melodischen Formen kann wohl auch nicht die Rede sein. Aber unwillkürlich bildet sich bei dem Dichter ein Gefühl aus, welche von den verschiedenen Formen für jeden Einzelfall die passendste ist, und aus diesem Gefühl heraus trifft er die Wahl seiner Formen im einzelnen. Das kann man deutlich da erkennen, wo ein Dichter zwei oder mehrere nach unserer Auffassung gegensätzliche Formen selbst in Gegensatz bringt. Ich erinnere in dieser Beziehung nur an den Faustmonolog, in dem die wechselnden Stimmungen Fausts in so wunderbarer Weise auch rhythmisch-melodischen Ausdruck gefunden haben, oder, um ein gröberes Beispiel zu [382] wählen, an Schillers Glocke, wo die auf den Glockenguß bezüglichen Strophen in melodischen Dipodien, die betrachtenden Strophen in reinen Monopodien gehalten sind.
Sie sehen, m. H., daß das, was ich Ihnen vortragen konnte, im besten Falle Bausteine zu einem später einmal aufzuführenden Gebäude abgeben kann. Soll dies Gebäude einmal wirklich erstehen, so braucht es dazu der hingebenden Zusammenarbeit vieler, vor allem um durch reichliche Beobachtung und Fixierung der als mustergültig erkannten Interpretationsformen, wie wir sie aus dem Munde des berufenen Künstlers hören, das subjektive Moment, das die Wertschätzung des einzelnen mit sich bringt, nach Kräften einzuengen und so allmählich zu einer objektiveren Grundlage zu gelangen. Von diesem Ziele sind wir jetzt noch weit entfernt, und der Weg selbst ist nicht immer dornenlos. Die Aufgabe selbst aber ist wichtig genug, um die aufgewandte Mühe reichlich zu lohnen: gelingt ihre Lösung, so werden wir, wie ich zuversichtlich hoffe, uns rühmen dürfen, einen neuen Schlüssel für das Verständnis der Kunstform der Rede unserer großen Dichter und ihrer Wirkung gefunden zu haben.