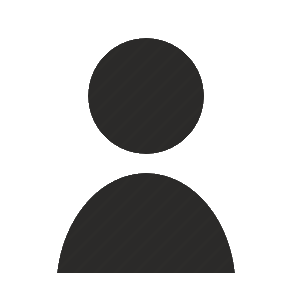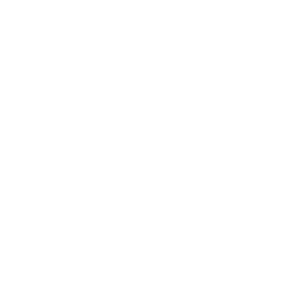This document is unfortunately not available for download at the moment.
Phänomenologische Ästhetik
Moritz Geiger
pp. 29-42
Die Kongreßleitung hat es nicht allzugut mit mir gemeint, als sie mit dem Wunsche an mich herantrat, ich möge einen Vortrag über »Phänomenologische Ästhetik« übernehmen. Phänomenologische Ästhetik — das ist Ästhetik, die nach einer bestimmten Methode betrieben wird — eben nach der phänomenologischen; und so wird es meine Aufgabe sein, über Eigenart und Bedeutung dieser Methode zu reden, ohne zeigen zu können, wie diese Methode zu konkreten Ergebnissen führt, ohne durch ihre Anwendung erweisen zu können, daß sie kein bloß theoretisches Gespinst ist.
Freilich, so ganz unbekannt ist die phänomenologische Methode heute nicht mehr. Sie hat bei der Durchführung mehr als einer ästhetischen Untersuchung die Feuerprobe bestanden, und auch unter den Kongreßankündigungen finden sich Hinweise auf ihre Verwendung. Ja, so wenig ist sie heute mehr unbekannt, daß derjenige, der zu ihr gelangen will, sich durch einen Berg von Mißverständnissen hindurcharbeiten muß. Bald hält man die phänomenologische Methode für eine Methode, die nichts zu tun hat, als Begriffe zu spalten, die Bedeutung von Worten festzulegen, weshalb sie sich nur im Logischen bewege und niemals an die Dinge selbst herankomme — Einwände, wie sie ihr z. B. Wundt gemacht hat. Dann wieder glaubt man im Gegenteil, sie solle genialischer Intuition zum Hintergrund dienen, die sich die Begründung ihrer Behauptungen ersparen will — wie ihr zuweilen von neukantischer Seite vorgeworfen wurde. Positivistische Gedankengänge berufen sich ebenso auf sie wie verstiegene Metaphysik. Bei solchem Chaos entgegengesetzter Anschauungen mag es vielleicht doch gar nicht so unratsam sein, den Reigen ideen- und ergebnisreicher Vorträge durch einen zu unterbrechen, der nichts sein will als ein trockener methodischer Versuch, nichts als eine Auseinandersetzung über die phänomenologische Methode in der Ästhetik.
Die Diskussion über Prinzipienfragen der Ästhetik wäre um vieles leichter, wenn man sich stets vor Augen halten wollte, daß der Name »Ästhetik« nicht ein einheitliches Wissenschaftsgebiet umschließt, sondern, daß »Ästhetik« ein Sammelname ist für eine Reihe unter sich völlig heterogener Wissenschaften, die man dennoch alle wegen ihrer Beziehung auf den ästhetischen Gegenstand als Ästhetik zu bezeichnen pflegt. Da jedoch jede dieser Wissenschaften, die sich Ästhetik nennen, eine andersgeartete Beziehung zur phänomenologischen Methode hat, so ist es notwendig, sich zuerst über diese verschiedenen Disziplinen der Ästhetik kurz zu orientieren, um würdigen zu können, wie die phänomenologische Methode in jeder von ihnen wirksam wird.
Dreierlei Arten heterogener Disziplinen werden unter dem gemeinsamen Namen »Ästhetik« begriffen: 1. Ästhetik als autonome Einzelwissenschaft, 2. Ästhetik als philosophische Disziplin und 3. Ästhetik als Anwendungsgebiet anderer Wissenschaften.
Von diesen drei Ausgestaltungen ästhetischer Wissenschaft hat lange Zeit die Ästhetik als philosophische Disziplin die beiden andern überschattet und in die Ecke gedrängt. Noch für Schelling und Hegel, für Schopenhauer und Ed. von Hartmann war der philosophische Charakter der Ästhetik kein Problem. Erst als die Philosophie, nach dem Zusammenbruch des Hegelschen Systems, ihre Grenzpfähle zurückstecken mußte, hat sie, seit Fechner, ihre Führerrolle im Gebiet der Ästhetik an die Psychologie abgeben müssen. Aber auch damit war die Ästhetik noch nicht zur autonomen Einzelwissenschaft geworden. Sie jedoch gerade ist es, die das Hauptanwendungsgebiet der phänomenologischen Methode bildet. Deshalb werde zunächst von der Ästhetik als autonomer Einzelwissenschaft gesprochen.
Jede Einzelwissenschaft — und demgemäß auch die Ästhetik als Einzelwissenschaft — wird in ihrer Einheit bestimmt durch ein Moment, das ihr Gebiet abgrenzt gegenüber den Gebieten anderer Wissenschaften. So ist für die Naturwissenschaften das Moment der Zugehörigkeit zur äußeren Natur einheitgebend, für die Geschichtswissenschaften das historische Geschehen. Es kann keinem Zweifel unterliegen, was für die Ästhetik als autonome Einzelwissenschaft dasjenige Moment ist, das ihr Gebiet gegenüber anderen Gebieten umreißt: Es ist das Moment des ästhetischen Wertes (wobei hier und im folgenden unter »ästhetischem« Wert stillschweigend auch der »künstlerische« miteinbegriffen sein soll). Alles, was den Stempel des ästhetischen Wertes tragen kann — alles, was als schön oder häßlich, originell oder trivial, sublim oder gemein, geschmackvoll oder kitschig, großzügig oder kleinlich bewertet werden kann — all das — Gedichte und Musikstücke, Gemälde und Ornamente, Menschen und Landschaften, Bauwerke, Gartenanlagen, Tänze — gehört in das Gebiet der Ästhetik als Einzelwissenschaft.
Ästhetischer Wert und Unwert irgend einer Modifikation aber kommt den Gegenständen nicht zu, insoweit sie reale Gegenstände sind, sondern nur insoweit sie als Phänomene gegeben sind. Er haftet an den anschaulichen Tönen einer Symphonie — den Tönen als Phänomenen — nicht daran, daß sie auf Luftschwingungen beruhen. Nicht als realer Block aus Stein ist die Statue ästhetisch von Bedeutung, sondern als das, was sie dem Beschauer gegeben ist, als die Darstellung eines Menschen. Und ästhetisch ist es völlig gleichgültig, daß die Darstellerin des Gretchen alt und häßlich ist und nur Toilettenkünsten, Schminke und Rampenlicht den Schein frischer Jugend verdankt — auf das Aussehen, nicht auf die Realität kommt es an.
Da so der ästhetische Wert oder Unwert nicht in der realen Beschaffenheit eines Gegenstandes, sondern in der phänomenalen Beschaffenheit beruht, so ist damit die vornehmste Aufgabe der ästhetischen Einzelwissenschaft vorgezeichnet. Sie muß die ästhetischen Gegenstände zunächst nach ihrer phänomenalen Beschaffenheit untersuchen. Es mag trivial klingen, daß die Ästhetik in dieser Weise die Gegenstände als Phänomene zu analysieren habe. Aber die Betrachtung der Geschichte der Ästhetik — auch wenn man nur die Geschichte der Ästhetik als Einzelwissenschaft heranzieht — zeigt, daß ein solches Ausgehen von den Phänomenen keineswegs selbstverständlich ist. Weite Richtungen in der Ästhetik stellen in den Mittelpunkt ihrer Betrachtungen den Gedanken, daß das Ästhetische Schein, daß es Illusion sei. Aber im Augenblick, wo man den Gedanken des Scheins in die Ästhetik einführt, zergliedert man nicht einfach die ästhetischen Phänomene, sondern trägt Realitätsgesichtspunkte hinein. Nach der phänomenalen Seite hin ist der ästhetische Gegenstand nicht Schein. Beim Schein — etwa, wenn man den Mond für tellergroß hält — schreibt man dem Phänomen eine Realität zu, die es nicht besitzt. Beim Ästhetischen hingegen wird die Landschaft auf einem Gemälde nicht als Realität aufgefaßt, nicht als ein Wirkliches, das sich nachher als unwirklich herausstellt, sondern als eine dargestellte Landschaft, als eine Landschaft, die als dargestellt gegeben ist. Sowie man den Illusionsgedanken, den Gedanken des Gegensatzes von gegebener Wirklichkeit und tatsächlicher Unwirklichkeit in die Ästhetik einführt, verläßt man das Gebiet des Phänomenalen.
Oder ein anderes Beispiel: Ein großer Teil der psychologischen Ästhetik faßt das Kunstwerk als einen Komplex von Vorstellungen, das Gemälde etwa als eine Zusammenfügung von Farbenempfindungen, Formeindrücken, Assoziationen und Verschmelzungen von Eindrücken. Mit solcher Auffassung hat man die Einstellung auf die Phänomene aufgegeben. Gegeben sind keine Empfindungen, keine Assoziationen und keine Verschmelzungen — gegeben sind vielmehr Objekte: Dargestellte Landschaften, Melodien, Menschen usw. Und wenn man nach der Begründung des Wertes der Darstellung einer Landschaft etwa fragt, so kann man sie in der Stimmung der Landschaft finden, in der Farbengebung, der Massenverteilung — in lauter Momenten also, die in den Phänomenen unmittelbar aufweisbar sind. Rein durch Rückgang auf die das Kunstwerk als Phänomen aufbauenden Momente sind also die Fragen der Ästhetik als Einzelwissenschaft lösbar.
Damit aber ist auch — und das sei das dritte Beispiel einer antiphänomenologischen Einstellung — für die Ästhetik als Einzelwissenschaft jene Methode abgewiesen, die alle ästhetischen Fragen vom Erleben her, durch Analyse des Erlebens zu entscheiden sucht: Man wolle etwa wissen, worin das Wesen des Tragischen bestehe. Ist es wirklich auf diese Frage eine Antwort, wenn ich mit Aristoteles (der in diesem Punkt völlig psychologisch denkt) angebe, das Tragische bewirke Furcht und Mitleid und durch sie eine Reinigung der Leidenschaften? Ist nicht eine solche Antwort derjenigen verwandt, die auf die Frage: Was ist das Wesen des Blitzes? antworten wollte: das Wesen des Blitzes bestehe darin, daß er Schrecken und Angst erzeuge, wenn er direkt neben jemandem in den Boden fährt. In beiden Fällen wird statt der Angabe, was eine Sache sei, zur Antwort gegeben, wie sie psychologisch wirkt. Was das Tragische, etwa bei Shakespeare, konstituiert, sind bestimmte Aufbaumomente des dramatischen Geschehens, also etwas im Objekt, nicht die psychologische Wirkung. Diese Wirkung liegt außerhalb des Problembereichs der Ästhetik als Einzelwissenschaft. Es wäre natürlich töricht, die Augen gegenüber diesen Problemen der psychischen Wirkung ästhetischer Gegenstände, gegenüber den Problemen des Erlebens zu verschließen, all jene Verfeinerungen der Analyse des ästhetischen Erlebens, wie sie die letzten Jahrzehnte seit und durch Nietzsche gebracht haben, beiseite schieben zu wollen. Hier liegen wesentliche ästhetische Probleme — nur in die Ästhetik als Einzelwissenschaft gehören sie nicht. Sie und viele andere Probleme, wie die der Entstehung des Kunstwerks im Bewußtsein des Künstlers und des Aufnehmenden, der individuelle Unterschied in der Aufnahme des Kunstwerks, gehören vielmehr in die Ästhetik als Anwendungsgebiet der Psychologie. Und hier treten in der Tat neben der phänomenologischen Methode all jene empirischen und experimentellen Methoden in ihr Recht, wie sie die psychologische Forschung der letzten Generation ausgebildet hat.
Innerhalb der Ästhetik als Einzelwissenschaft hingegen, wo es sich um die Struktur der ästhetischen und künstlerischen Gegenstände und ihre Wertbestimmtheit handelt, kann nur die Analyse der Objekte selbst zum Ziele führen. Die phänomenologische Ästhetik steht hier ganz auf dem Boden jenes Objektivismus, den Dessoir vor einem Jahrzehnt programmatisch für die Ästhetik hervorgehoben, und dem Utitz eine eingehende Untersuchung gewidmet hat.
In diesem Ausgehen vom Objekt begegnet sich die Ästhetik mit den Kunstwissenschaften. Ihnen hat es stets ferngelegen, das Erleben in den Vordergrund zu stellen oder das Objekt in Vorstellungen aufzulösen. Sie haben von jeher in der Zergliederung des phänomenalen Objekts ihre wesentlichste Aufgabe gesehen. Der Kunsthistoriker analysiert den Faltenwurf des Gewandes, den Ausdruck, das Antlitz einer Madonna, der Musikhistoriker den Aufbau eines symphonischen Werkes usf.
Allein nur der Ausgangspunkt vom Phänomen ist dem Historiker der Kunst und dem Ästhetiker gemeinsam. Nicht das einzelne Kunstwerk, nicht das Botticellische Gemälde, die Bürgersche Ballade, die Brucknersche Symphonie ist für den Ästhetiker von Interesse, sondern das Wesen der Ballade überhaupt, der Symphonie überhaupt, das Wesen der verschiedenen Arten der Zeichnung, das Wesen des Tanzes usw. Für allgemeine Strukturen interessiert er sich, nicht für einzelne Gegenstände. Und daneben für die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten der ästhetischen Werte, für die prinzipielle Art, wie sie in ästhetischen Gegenständen ihr Fundament finden.
Wie aber kann die Ästhetik aus der Zergliederung der Gegenstände heraus zu solchen allgemeinen Strukturen und Gesetzmäßigkeiten vordringen? Jene Methode, die von oben her, aus einem einzigen obersten Prinzip, zu Ergebnissen zu gelangen suchte, etwa aus dem Prinzip: Kunst ist Nachahmung, oder: ästhetisch wertvoll ist Einheit in der Mannigfaltigkeit — diese Methode ist heute längst aufgegeben und braucht nicht mehr diskutiert zu werden. So liegt es nahe, den umgekehrten Weg zu versuchen, statt von oben, von unten her an das Problem heranzukommen, induktiv vorzugehen. Man sucht etwa, um das allgemeine Wesen des Tragischen festzustellen, das Tragische bei Sophokles, bei Racine, bei Shakespeare, bei Schiller usw. auf, und dasjenige, was sich überall und bei allen findet, das eben ist das Wesen des Tragischen.
Allein dieser induktive Weg — so oft man ihn auch propagiert hat, ist ein Fehlschlag: Denn um das Tragische auch nur bei einem einzigen Dichter aufzeigen zu können, muß man schon implizite mit dem Wesen des Tragischen vertraut sein. Weshalb suchte man es sonst im Hamlet und Macbeth und nicht im Sommernachtstraum? Daß im einen Drama die Menschen am Leben bleiben und im anderen sterben, kann doch nicht hinlänglicher Grund dafür sein; man wird doch nicht etwa wegen ihres gewaltsamen Todes Polonius oder gar Rosenkranz und Güldenstern neben Hamlet als tragische Figuren gelten lassen. Also muß es möglich sein, schon im einzelnen Kunstwerk, nicht erst in der Abfolge der Dramen das Wesen des Tragischen zu finden. Es muß neben der Einzelanalyse des tragischen Kunstwerks, wie sie der Literarhistoriker vornimmt, auch noch die Möglichkeit bestehen, am Einzelkunstwerk das Allgemeine, das allgemeine Wesen des Tragischen zu entdecken. Das ist in der Tat der Fall. Es werde eine andere Wissenschaft zum Vergleich herangezogen: Der Mathematiker zeichnet zwei sich schneidende gerade Linien; dann mag er sich für diesen einzelnen Fall von Geradenpaaren interessieren, er mag etwa feststellen, in welchem Winkel sich diese beiden geraden Linien schneiden, — gerade so wie der Literarhistoriker das einzelne Kunstwerk in seiner individuellen Beschaffenheit analysiert. Er kann aber auch an diesem einzelnen Beispiel sich den allgemeinen Satz klar machen, daß zwei gerade Linien sich stets nur in einem Punkte schneiden können, er kann an diesem einzelnen Beispiel das Wesen der Beziehung von Punkt und Gerade im euklidischen Raum erschauen. In ähnlicher Weise läßt sich auch an jedem einzelnen tragischen Kunstwerk das allgemeine Wesen des Tragischen erschauen: Das einzelne Kunstwerk wird gleichsam transparent. Man sieht durch es hindurch — es wird zum bloßen Symbol des Wesens des Tragischen, das man darin erfaßt.
Das ist eine weitere Eigenart der phänomenologischen Methode: Daß sie weder aus einem obersten Prinzip heraus ihre Gesetzmäßigkeiten gewinnt, noch auch durch die induktive Häufung einzelner Beispiele, sondern dadurch, daß sie am einzelnen Beispiel das allgemeine Wesen, die allgemeine Gesetzmäßigkeit erschaut.
Ein erstes Merkmal phänomenologischer Methode war, daß sie bei den Phänomenen stehen bleibt, daß es ihr um die Untersuchung der Phänomene zu tun ist. Ein zweites Merkmal bestand darin, daß sie diese Phänomene nicht in ihrer zufälligen und individuellen Bedingtheit, sondern in ihren Wesensmomenten zu erfassen strebt. Das dritte: daß dieses Wesen weder durch Deduktion noch durch Induktion, sondern durch Intuition erfaßt werden soll.
Allein — so hat man oft eingewendet — macht man es sich denn doch gar zu leicht, wenn man die Forderung der intuitiven Wesenserfassung aufstellt? Solche Intuition scheint die bequemste Sache von der Welt zu sein. Kein langes Studium, keine großen Kenntnisse scheinen dazu erforderlich. Man sieht sich ein Kunstwerk an und erschaut darin das Wesen des Tragischen — man nimmt sich eine Zeichnung vor und erschaut daran das Wesen der Zeichnung. An Stelle der Forschung Intuition, an Stelle der Kenntnisse Intuition, an Stelle der Beweise Intuition.
Solche Vorwürfe gehen nach zwei Richtungen an den Schwierigkeiten der Intuition vorbei: Man muß das Objekt in die richtige Verfassung gebracht haben, damit man an ihm ein allgemeines Wesen intuieren kann, und muß zuvor noch das untersuchende Subjekt in die richtige Verfassung gebracht haben, damit es überhaupt die richtige Intuition ausüben kann.
Wenn man das Objekt — ein Kunstwerk — als Ganzes anschaut, so wird man nie imstande sein, darin irgend ein Wesen zu erfassen. Man muß es analysieren, damit solche Wesenserfassung gelingt. Das ist ein weiteres Moment der phänomenologischen Methode, daß sie nicht schlechthin Erschauung komplexer Gegenstände, sondern daß sie zugleich Analyse bedeutet. So einfach, wie in jenem primitiven mathematischen Beispiel, bei dem man nur die Figur anzuschauen brauchte, damit der allgemeine Satz, daß zwei gerade Linien sich nur in einem Punkt schneiden, heraussprang, so einfach ist die Erfassung des Wesens ästhetischer Phänomene nicht. Man wird z. B. nur in langsamer mühseliger Arbeit herausanalysieren können, welches denn nun im Kunstwerk die Momente sind, die das Tragische aufbauen. Man wird das dramatische Geschehen gedanklich variieren müssen, um die Wesensmomente des Tragischen aufzufinden. Und man wird das Tragische in anderen Zeiten und bei anderen Völkern und in anderen Künsten, im historischen Geschehen und vielleicht auch in der Natur heranziehen müssen, um die Wesensmomente des Tragischen rein erfassen zu können. Sonst mag es geschehen, daß man etwa die besondere Ausprägung der Schillerschen Tragik für das Wesen des Tragischen überhaupt ansieht. Wer wirklich nur das einzelne Kunstwerk oder die Werke des einzelnen Künstlers analysiert und andere Künstler und andere Zeiten vernachlässigt, gerät in die Gefahr, Zufälliges und Zeitbedingtes für ein Wesenhaftes und Allgemeingültiges zu halten.
Und noch einer weiteren Gefahr droht man durch die Nichtbeachtung der Entwicklung zu erliegen: Der Gefahr, die aus der Vieldeutigkeit und dem Wandel des sprachlichen Ausdrucks kommt. Vielleicht haben andere Zeiten Anderes als tragisch bezeichnet, als wir heute tun. Hier muß festgestellt werden, ob sich hinter dem einheitlichen Namen des Tragischen nicht ganz Verschiedenartiges verbirgt, ob in der Antike und heute das Tragische wirklich dasselbe bedeutet, oder ob es sich um verschiedene Phänomene handelt, für die natürlich dann auch die Wesensanalyse verschieden ausfallen müßte. Das alles erfordert mehr als ein bloßes den Kopf-in-die-Hand- Stützen und Anschauen — es erfordert umfassende Kenntnisse und umfangreiche Vorarbeiten.
Allein diese Bedeutung der Hereinnahme historischer Fakten in die phänomenologische Methode ist rein negativer Natur, — es sollen durch die Breite der historischen Basis Fehler im Erfassen des Wesens des Tragischen vermieden werden. Prinzipiell jedoch ist die Erschauung des Wesens des Tragischen am einzelnen Kunstwerk vollkommen sicher und eindeutig zu vollziehen, ohne Rücksichtnahme auf die historische Entwicklung.
Hat jedoch das Historische wirklich einzig diese methodisch-negative Bedeutung innerhalb der phänomenologischen Methode? Richtet sich die phänomenologische Methode wirklich nur auf das immer gleichbleibende außerzeitliche Wesen?
Mit dieser Frage sind wir auf ein vielumstrittenes Problem gestoßen: auf die Frage nach dem Verhältnis von phänomenologi- scher Methode und Geschichte. Von den bisher gewonnenen Gesichtspunkten aus kann das Verhältnis von Geschichte des Tragischen und dem Wesen des Tragischen nur im folgenden bestehen: Wie sich das immer gleiche Wesen des Dreiecks in einzelnen Dreiecken von ganz verschiedenen Seitenlängen konkretisiert, so konkretisiert sich das immer gleiche Wesen des Tragischen (oder die immer gleichen Wesen der verschiedenen Modifikationen des Tragischen) in den verschiedensten Formen bei Sophokles, bei Shakespeare, bei Racine, bei Schiller usw. Es ist die platonische Idee, die dieser Konzeption des Wesens Pate gestanden hat, und bei Plato wie bei der Phänomenologie war das Vorbild der Mathematik mit ihren ahistorischen Begriffen ausschlaggebend für die Formung des Wesensbegriffs.
Aber von dieser Auffassung des Wesens her gelangt man nicht zu einem Verständnis einer wirklichen historischen Entwicklung. Die Entwicklung des Tragischen bei Shakespeare, etwa von den Äußerlichkeiten der frühen Tragödien über Romeo und Julia zu König Lear, ist mehr als ein bloßer Sprung von einer Auffassung des Tragischen zur anderen, und mehr als bloße wechselnde Konkretisierung des immer gleichen Wesens des Tragischen, obwohl beides gewiß eine Rolle spielt. Allein wirkliche Entwicklung ist etwas anderes — etwas, dem man nicht mit einem statischen Wesensbegriff nahe kommen kann, der in der Mathematik seinen Ursprung hat, sondern nur mit einem dynamischen. Ein biologisches Beispiel möge das verdeutlichen: Das Wickelkind, der Jüngling, der reife Mann, der Greis lassen sich alle gewiß als Ausgestaltungen des stets gleichen Wesens des Menschen auffassen, da sie ja alle Menschen sind; aber ist damit wirklich das Entscheidende gesagt? Muß hier nicht ein Wesensbegriff verwandt werden, der das Wesen des Menschen selbst als ein sich Entfaltendes, als ein sich Entwickelndes faßt? Entsprechend kann man der Entwicklung des Tragischen nicht gerecht werden, wenn man nur das immergleiche Wesen des Tragischen herausschält — das Tragische selbst muß als der Veränderung, der inneren Umgestaltung, der Entwicklung fähig angesehen werden. Erst wenn man das Wesen des Tragischen in, dieser Weise flüssig gemacht hat, kann man die Entwicklung des Tragischen verstehen — erst dann wird der Wesensbegriff zum Hilfsmittel der historischen Betrachtung. Die platonische Idee, die starr platonische Auffassung des Wesens ist grundlegend für die ästhetische Prinzipienwissenschaft. Sollen jedoch die Ergebnisse der Ästhetik fruchtbar gemacht werden für die Betrachtung der geschichtlichen Entwicklung, so bedarf es einer Erweichung der platonischen Idee durch einen Zusatz Hegelschen Geistes.
Aber all diese Scheidungen, Analysen und Erschauungen wird nur ein Subjekt vornehmen können, das genügend geschult ist. Es mag sein, daß diese Intuitionen, die nötig sind, um das Wesen zu erforschen, gar nicht mehr allzuschwer sind, wenn das Subjekt überhaupt erst einmal imstande ist, sie vorzunehmen. Aber hierzu ist ein langer Weg der Schulung in Wesensanalysen nötig — eine Erziehung, die anders ist als bei anderen Methoden, aber nicht weniger schwierig. Es gilt, wirklich die Momente, auf die es ankommt, heraussehen zu lernen, sich nicht durch Nebengesichtspunkte und durch Vorurteile ableiten zu lassen, sich wirklich an die Phänomene und nur an die Phänomene zu halten. Solche Schulung jedoch ist nicht zu gewinnen durch das Anhören ästhetischer oder psychologischer Vorlesungen, nicht durch Aneignung fremder Meinungen oder historischer Kenntnisse, sondern einzig durch Selbsttätigkeit, durch selbsttätige Analysen. Und insofern ist der Vorwurf, daß die phänomenologische Methode es sich allzu leicht mache, sicherlich nicht berechtigt.
Freilich hängt mit dieser Notwendigkeit von Schulung und Begabung, um die Ergebnisse der phänomenologischen Methode einsehen zu können, ein Übelstand der Methode zusammen, der sich nicht beseitigen läßt: Es gibt keine objektiven Kriterien für die Richtigkeit der gefundenen Ergebnisse. Das besagt nicht, daß die Ergebnisse der Methode bloß subjektiver Natur seien — nur soviel, daß man keine objektiven Mittel hat, um sie dem Widerstrebenden aufzuzwingen. Wem der Blick verschleiert ist, wer nicht die nötige Schulung und Begabung besitzt, der wird nicht imstande sein, die Richtigkeit der gewonnenen Ergebnisse einzusehen. Man wird ihm nicht beweisen können, daß die Analysen richtig sind. Man wird einzig versuchen können, ihm die Augen zu öffnen; man wird ihn allmählich zu den Ergebnissen hinführen, ihn die richtige subjektive Einstellung gewinnen lassen, aber man kann die Ergebnisse nicht wie Pflanzen oder Steine oder wie physikalische Experimente jedermann vordemonstrieren.
Wir sind durch den sozusagen demokratischen Charakter der Naturwissenschaft verwöhnt — wir glauben, sie müsse jedem zugänglich sein, der nur das nötige Sitzfleisch aufbringt und jene logische Begabung besitzt, die wir wenigstens prinzipiell als allgemeingültig voraussetzen. Solche Zugänglichkeit trifft schon für die Historie im echten Sinn nicht zu: Die geistige Aufnahme des Materials ist jedem erreichbar, aber einen komplizierteren menschlichen Typus wie den eines Wallenstein, eines Richelieu, eines Friedrich des Großen zu verstehen, ist den wenigsten gegeben. Wer nur in den gewöhnlichen oberflächlichen psychologischen Kategorien zu denken gewohnt ist, wird ihnen nicht nahe kommen — selbst dort, wo ein großer Historiker vorgedacht hat. In noch höherem Maße fast als die verstehenden Geisteswissenschaften sind die Wissenschaften, die sich auf die phänomenologische Methode stützen, aristokratischer Natur. Selbst die Wesensmomente, die andere bereits erschaut haben, wird derjenige nicht erschauen können, dem die Begabung hierzu fehlt.
Dieser aristokratische Charakter der phänomenologischen Methode bedeutet eine Schwierigkeit für ihre Benutzung, aber keinen Einwand gegen ihre Richtigkeit. Ist sie die richtige, die dem Tatbestand angemessene Methode, so muß man alle Übelstände, die sich aus ihr ergeben, mit in den Kauf nehmen — man kann jedoch keinesfalls eine unangemessene Methode befolgen, nur weil ihre Ergebnisse, wenn sie richtig wären, leichter demjenigen beweisbar wären, der sie nicht zugeben will.
Daß in der Tat die phänomenologische Methode zum Ziele führt, das geht daraus hervor, daß letztlich alle Ergebnisse, die im Laufe der Geschichte an bleibenden kunstwissenschaftlichen und ästhetischen Einsichten gewonnen wurden, auf dem Wege phänomenologischer Versenkung in das Wesen der Tatsachen gefunden wurden, mögen auch die Entdecker dieser Einsichten sich dessen nicht bewußt gewesen sein und ganz andere, meist zeitbedingte Begründungen für ihre Ergebnisse herangeholt haben. Was an Lessings Trennung von Dichtkunst und bildender Kunst haltbar ist, das hat er durch die unbewußte Anwendung der phänomenologischen Methode gefunden. Dort, wo er sie, Analogien zwischen den beiden Kunstarten zuliebe, verläßt, dort beginnen seine Irrtümer, so wenn er etwa die Farben als Zeichen für die Gegenstände ansieht. So sind Schillers Untersuchungen über Anmut und Würde, über das Erhabene, über das Naive und Sentimentalische glänzende Beispiele phänomenologischer Analysen, soweit nicht Kantische Konstruktionen ihm das Konzept verderben. So sind, um nur noch ein Beispiel anzuführen, die besten Ergebnisse von Fiedlers und Hildebrands Kunsttheorien trotz ihrer scheinbar ganz andersartigen Begründungen phänomenologische Einsichten. All solche Erkenntnisse sind weder durch Methode von oben gewonnen noch durch Methode von unten, sondern durch Wesensintuition.
Gerade jedoch, daß solche
Einsichten phänomenologisch gewonnen werden konnten, mitten in Zeiten, die prinzipiell anderen Methoden zugetan waren, zeigt, daß die phänomenologische Methode doch nicht
so völlig abseits von den anderen Methoden ihren Weg sucht. Sie steht vielmehr in Wahrheit mitten inne zwischen der Ästhetik von unten und der Ästhetik von oben. Mit der
Ästhetik von unten verbindet sie das Wertlegen auf die eingehendste Beobachtung, der Wille zur unkonstruktiven Beschreibung des Tatsächlichen. Aber dies Tatsächliche ist ihr
nicht der Inhalt der zufälligen Einzelbeobachtung, sondern das Wesen, das im Einzelnen sich findet und realisiert. Und damit nähert sich die phänomenologische Ästhetik auch
wiederum der Ästhetik von oben. Denn, wie hat die Ästhetik von oben ihre obersten Prinzipien gewonnen — etwa das Prinzip der Einheit in der Mannigfaltigkeit? Nur scheinbar aus
metaphysischen Überlegungen. In Wahrheit, indem sie an einer Reihe von Beispielen einsah, daß ästhetische Geltung auf einem solchen Prinzip beruhe. Ihr Fehler lag nur darin, daß
sie das am einzelnen Beispiel Erschaute sofort verallgemeinerte, die Orientierung an der Einsicht in das Wesen der Tatsachen wieder aufgab und das einmal gewonnene Prinzip an
den Anfang der Ästhetik stellte. So machte die Methode von oben, wenn sie das Prinzip »Kunst ist Abbildung» zum Grundprinzip wählte, eine Einsicht, die wenigstens eine Seite
von Malerei und Plastik erfaßte, nicht nur zum alleinigen Prinzip von Malerei und Plastik, sondern übertrug es unbesehen auf alle Künste, auf Dichtkunst so gut wie auf Architektur
und Ornamentik und Musik und führte es damit ad absurdum. Der Systemtrieb, der Wunsch, möglichst rasch zu einem geschlossenen System der Ästhetik
zu kommen, hat ihr die Augen verschlossen gegenüber der Mannigfaltigkeit der Wertmomente und ästhetischen Gestaltungen.
Auch die phänomenologische Ästhetik möchte keineswegs auf das System verzichten, aber es kann ihr nicht am Anfang stehen. Zuerst muß sie das Einzelne untersuchen. In jeder Kunst und in jedem Naturgebiet müssen die Wertmomente und ihre wesentlichen Gestaltungen gesondert aufgesucht werden — dann wird sich sicherlich zeigen, daß sie nicht ein regelloses Durcheinander bilden, sondern daß eine kleine Zahl von ästhetischen Prinzipien sich immer wiederholt, die je nach Art und Struktur des Kunst- oder Naturgebildes in völlig verschiedener Weise Gestalt gewinnen.
Das ist das Letzte, was die Ästhetik, als autonome Einzelwissenschaft, erreichen kann: Daß sie das ganze ästhetische Gebiet mit Hilfe einer kleinen Zahl von Wertprinzipien überspannt. Weiter kann die Ästhetik als Einzelwissenschaft nicht gehen — die Frage nach Bedeutung und Herkunft dieser Prinzipien überläßt sie der Ästhetik als philosophischer Disziplin.
Diese Ästhetik als philosophische Disziplin verhält sich zur Ästhetik als Einzelwissenschaft etwa wie die Naturphilosophie zur Naturwissenschaft. Die Naturwissenschaft setzt die Existenz der äußeren Natur voraus und erforscht deren Gesetze. So setzt die Ästhetik als Einzelwissenschaft die Tatsache des ästhetischen Wertes voraus und sucht deren Prinzipien zu erforschen. Die Naturphilosophie ihrerseits untersucht die Existenz dieser äußeren Natur, sie faßt sie realistisch oder idealistisch auf, als Erscheinung eines Dings an sich oder als Konstruktion aus den Wahrnehmungen, und die Gesetze dieser Natur sieht sie als Zusammenfassungen von Tatsachen an oder als Ausgestaltungen äußerer Gesetzmäßigkeiten — lauter Auffassungen, die für die Naturwissenschaft gänzlich irrelevant sind. Ähnlich stellt sich die philosophische Ästhetik zu den Grundlagen der einzelwissenschaftlichen Ästhetik, zum ästhetischen Wert und den ästhetischen Wertprinzipien. Sie macht sich Gedanken über den ästhetischen Wert — sie setzt ihn nicht voraus. Sie sieht ihn mit Plato an als eine Abspiegelung eines Überirdischen im Irdischen, mit Schelling als eine Darstellung des Unendlichen im Endlichen, oder sie vergleicht mit Kant den ästhetischen Wert mit anderen Wertkategorien, dem Guten und Angenehmen, und stellt seinen philosophischen Ort fest.
Ich glaube nicht, daß zur Beantwortung dieser philosophisch-ästhetischen Aufgaben die phänomenologische Methode das letzte Wort zu sprechen hat, aber für bestimmte unumgängliche Vorfragen ist sie die notwendige Hilfe. Es sind ganz bestimmte philosophisch-ästhetische Problemgruppen, für die die phänomenologische Methode von Bedeutung ist: Die ästhetische Welt — ästhetische Gegenstände und ästhetische Werte — sind als Phänomene gegeben und werden in der einzelwissenschaftlichen Ästhetik nur als solche betrachtet. Aber man kann darauf reflektieren, daß sie als Phänomene eben Phänomene für ein Ich sind; daß es ein Ich ist, das auf der Leinwand die Landschaft sich gegenüberstellt, daß es ein Ich ist, das das Tragische aus sich heraussetzt, dem dramatischen Geschehen einlegt. Und da nun kann man auf die Akte reflektieren, in denen solcher Aufbau der Phänomenweit durch das Ich geschieht. Ziehen wir etwa das Verhältnis von Wort und Bedeutung als Beispiel heran. Blicken wir auf das Phänomen hin, so müssen wir sagen: Das Wort hat seine Bedeutung. Aber es läßt sich auch auf das Phänomen in seiner Abhängigkeit vom Ich reflektieren, darauf, daß ein Ich es ist, das dem Wort seine Bedeutung verleiht, erst dies Ineinander schafft, das man das Verhältnis von Wort und Bedeutung nennt. Man kann sich nun auch für die Akte interessieren, in denen durch das Ich dies Verhältnis geschaffen wird, — im angeführten Beispiel also für die bedeutungverleihenden Akte — und sie nun weiter analysieren; und auch bei solcher Untersuchung derjenigen Akte und Funktionen, in denen das Ich die ästhetische Welt aufbaut, handelt es sich nicht um zufällige individuelle Tatsachen, in unserem Beispiel nicht darum, daß zufällig der Mensch dieses Wort mit dieser Bedeutung verbindet. Sondern die wesensmäßig notwendigen Akte stehen in Frage, durch die das Wort überhaupt zu Bedeutungen gelangt. Derartige Konstitutionsprobleme sind es, die durch phänomenologische Wesensuntersuchungen entschieden werden können, und die in das Gebiet der Ästhetik als philosophischer Disziplin gehören.
Allein das erste und wesentliche Problemgebiet der phänomenologischen Methode innerhalb der Ästhetik liegt in der Behandlung der Ästhetik als Einzelwissenschaft. Ja, in dieser einzelwissenschaftlichen Ästhetik liegt vielleicht das vornehmste Anwendungsgebiet der phänomenologischen Methode überhaupt. Sowie Realitätsfragen ins Spiel kommen, wie etwa in den Naturwissenschaften, oder Fragen schlußmäßig beweisbarer Abhängigkeiten, wie in der Mathematik, treten andere Methoden in den Vordergrund. Die ästhetische Wissenschaft ist eine von den wenigen Disziplinen, die nicht die reale Wirklichkeit ihrer Gegenstände erforschen will, sondern für die die phänomenale Beschaffenheit entscheidend ist. Wenn irgendwo, so wird gerade hier die phänomenologische Methode zu zeigen haben, was sie zu leisten vermag.
Nicht, was diese Methode in der Ästhetik geleistet hat, sondern wie ihre Intentionen sind, und was sie glaubt leisten zu können — das in Kürze zur Diskussion zu stellen, war die Absicht dieses Vortrags. Ich bin mir, indem ich immer nur von Methode und niemals von Ergebnissen sprach, vorgekommen wie der Ausrufer vor den Jahrmarktbuden, der den Vorübergehenden anpreist, was sie alles in seiner Bude zu sehen bekommen würden, wenn sie sich nur entschließen könnten einzutreten. Man kann glauben, daß man das wirklich alles zu sehen bekommt, wenn man eintritt, man kann achselzuckend vorbeigehen — nur dem, der eintritt, kann sich zeigen, ob der Ausrufer zu viel des Merkwürdigen versprochen hat. So auch liegt die letzte Bewährung all dessen, was ich als wesentlich für die phänomenologische Methode aufgewiesen habe, nicht in methodischen Versprechungen, sondern in ihrer Durchführung an den einzelnen Problemen, die hier vorzunehmen nicht meine Aufgabe sein kann.